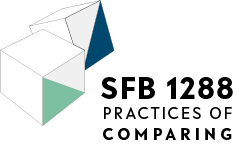Description:
These are the OCR results for the 1516 published version of the book Utopia written by Thomas Moore. The OCR results have been produced with tesseract.
Upload:
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><teiHeader><fileDesc><titleStmt><title>Untitled Document</title><author/></titleStmt><editionStmt><edition><date/></edition></editionStmt><publicationStmt><p>no publication statement available</p></publicationStmt><sourceDesc><p>Written by OpenOffice</p></sourceDesc></fileDesc><revisionDesc><listChange><change><name/><date/></change></listChange></revisionDesc></teiHeader><text><body><p>The Project Gutenberg EBook of Utopia, by Thomas Morus </p><p>This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with </p><p>almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or</p><p>re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included </p><p>with this eBook or online at www.gutenberg.net </p><p>Title: Utopia </p><p>Author: Thomas Morus </p><p>Release Date: October 20, 2008 [EBook #26971] </p><p>Language: German </p><p>Character set encoding: ISO-8859-1 </p><p>*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK UTOPIA *** </p><p>Produced by Norbert H. Langkau, Jana Srna and the Online </p><p>Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net </p><p> [ Anmerkungen zur Transkription:</p><p> Im Original gesperrt gedruckter Text wurde mit _ markiert.</p><p> Schreibweise und Interpunktion wurden �bernommen; lediglich</p><p> offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Eine Liste der</p><p> vorgenommenen �nderungen findet sich am Ende des Textes.</p><p> ]</p><p> THOMAS MORUS</p><p> UTOPIA</p><p> Verlag von Philipp Reclam jun. Leipzig</p><p> LIBELLUS VERE AUREUS NEC</p><p> minus salutaris quam festivus de optimo reip.</p><p> statu, deque nova Insula Utopia autore clarissimo</p><p> viro Thoma Moro inclutae civitatis</p><p> Londinensis cive & vicecomite cura M. Petri</p><p> Aegidii Antverpiensis, & arte Theodorici</p><p> Martini Alustensis, Typographi almae</p><p> Lovaniensium Academiae nunc</p><p> primum accuratissime</p><p> editus.</p><p> Cum gratia & privilegio.</p><p> Titel der Erstausgabe aus dem Jahre 1516</p><p>VORREDE </p><p>zu dem Werke �ber den besten Zustand des Staates </p><p>Thomas Morus gr��t seinen Peter �gid aufs herzlichste. </p><p>Fast sch�me ich mich, mein liebster Peter �gid, da� ich Dir dies </p><p>B�chlein �ber den Staat von Utopien erst nach beinahe einem Jahre </p><p>schicke. Hast Du es doch ohne Zweifel innerhalb von anderthalb Monaten </p><p>erwartet, da mir ja, wie Du wu�test, bei diesem Werke die M�he der </p><p>Erfindung des Stoffes abgenommen war und ich mir auch in betreff der </p><p>Gliederung nichts auszudenken brauchte. Denn ich hatte nur das </p><p>wiederzugeben, was ich mit Dir zusammen Raphael gerade so hatte erz�hlen </p><p>h�ren. Deshalb lag auch kein Anla� vor, mich hinsichtlich des Stiles </p><p>abzum�hen. Raphael konnte sich ja gar nicht gesucht ausdr�cken; denn </p><p>erstens sprach er, ohne da� er es vorher wu�te und sich vorbereiten </p><p>konnte, sodann ist er, wie Du wei�t, im Lateinischen nicht so zu Hause </p><p>wie im Griechischen, und schlie�lich kommt meine Rede der Wahrheit um so </p><p>n�her, je mehr sie sich seiner nachl�ssigen und schlichten </p><p>Ausdrucksweise n�hert, und um die Wahrheit allein mu� und will ich mich </p><p>bei dieser Sache k�mmern. </p><p>Ich gebe denn auch zu, mein Peter, das, was ich vorfand, hatte mir so </p><p>viel Arbeit abgenommen, da� fast nichts mehr zu tun �brigblieb. </p><p>Andernfalls h�tte ja auch Erfindung oder Gliederung des Stoffes nicht </p><p>wenig Zeit und Studium eines nicht unbedeutenden und recht gelehrten </p><p>Geistes erfordert. W�rde man nun nicht blo� eine der Wahrheit </p><p>entsprechende, sondern auch geschmackvolle Darstellung verlangen, so </p><p>h�tte ich das nicht leisten k�nnen, auch wenn ich all meine Zeit und all </p><p>meinen Eifer aufgewendet h�tte. So aber, da diese Schwierigkeiten </p><p>wegfielen, die zu bew�ltigen viel Schwei� gekostet h�tte, blieb einzig </p><p>und allein die einfache Aufzeichnung dessen �brig, was ich geh�rt hatte, </p><p>und das war wirklich keine Arbeit mehr. Aber selbst zur Erledigung </p><p>dieser so unbedeutenden Arbeit lie�en mir meine �brigen Gesch�fte fast </p><p>noch weniger als keine Zeit. Nehmen mich doch dauernd meine </p><p>Gerichtssachen in Anspruch. Bald f�hre ich einen Proze�, bald bin ich </p><p>Beisitzer, bald schlichte ich einen Handel als Schiedsrichter, bald </p><p>entscheide ich einen anderen als Richter, bald besuche ich diesen in </p><p>einer amtlichen, bald jenen in einer gesch�ftlichen Angelegenheit. </p><p>W�hrend ich so fast den ganzen Tag au�erhalb meines Hauses fremden </p><p>Leuten und nur den Rest meinen Angeh�rigen widme, kann ich f�r mich, </p><p>d.�h. f�r meine Studien, nichts er�brigen. Denn komme ich nach Hause, so </p><p>mu� ich mit meiner Frau plaudern, mit den Kindern schwatzen und mit dem </p><p>Gesinde sprechen. Alles das rechne ich zu meinen Pflichten, weil es </p><p>erledigt werden mu�. Es mu� aber erledigt werden, wenn man nicht in</p><p>seinem eigenen Hause ein Fremdling sein will. Man mu� sich �berhaupt </p><p>M�he geben, so liebensw�rdig wie m�glich zu denen zu sein, die einem die </p><p>Natur als Begleiter auf dem Lebenswege vorgesehen oder die der Zufall </p><p>oder eigene Wahl dazu gemacht hat. Nur darf man sie nicht durch </p><p>Leutseligkeit verderben und die Diener nicht durch Nachsicht zu seinen </p><p>Herren werden lassen. �ber dem, was ich angef�hrt habe, geht ein Tag, </p><p>geht ein Monat, geht ein Jahr hin. Wann also komme ich da zum Schreiben? </p><p>Und dabei habe ich noch gar nicht vom Schlafen gesprochen und auch noch </p><p>nicht einmal vom Essen, das bei vielen Leuten nicht weniger Zeit in </p><p>Anspruch nimmt als der Schlaf, der fast die H�lfte der Lebenszeit f�r </p><p>sich beansprucht. Aber f�r mich gewinne ich nur so viel Zeit, wie ich </p><p>mir vom Schlafen und Essen abstehle. Weil das nur wenig ist, so habe ich </p><p>die Utopia auch nur langsam fertiggebracht; weil es aber immerhin etwas </p><p>ist, so ist sie doch nun endlich fertig geworden, und ich schicke sie </p><p>Dir zu, damit Du sie liest und mich darauf aufmerksam machst, falls mir </p><p>etwas entgangen sein sollte. Nun habe ich freilich in dieser Beziehung </p><p>ziemlich viel Zutrauen zu mir -- ich wollte, mit meinem Geiste und mit </p><p>meinem Wissen st�nde es ebenso wie mit meinem Ged�chtnis, das mich nur </p><p>manchmal im Stiche l��t�--, doch ist mein Zutrauen nicht so gro�, da� </p><p>ich annehmen d�rfte, mir k�nnte nichts entfallen sein. Denn auch mein </p><p>Famulus, Johannes Clemens, hat mich sehr bedenklich gestimmt. Wie Du ja </p><p>wohl wei�t, war er damals dabei, und ich lasse ihn an jeder Unterhaltung </p><p>teilnehmen, aus der er etwas lernen kann; denn von diesem Sch��ling, der </p><p>im Lateinischen wie im Griechischen zu gr�nen begonnen hat, erhoffe ich </p><p>dereinst einen guten Ertrag. Soviel ich mich n�mlich erinnere, hat </p><p>Hythlodeus erz�hlt, jene Br�cke von Amaurotum �ber den Flu� Anydrus sei </p><p>500 Doppelschritte lang. Mein Johannes aber meinte, man m�sse 200 </p><p>abziehen; der Flu� sei dort nicht breiter als 300 Doppelschritte. </p><p>Besinne Dich doch bitte noch einmal darauf! Wenn Du n�mlich der gleichen </p><p>Meinung bist wie Johannes, so will auch ich zustimmen und einen Irrtum </p><p>meinerseits annehmen. Solltest Du aber selbst Dich nicht mehr besinnen </p><p>k�nnen, so bleibt stehen, worauf ich mich selbst zu besinnen glaube. </p><p>Wenn ich mich n�mlich auch vor jeder falschen Angabe in dem Buche streng </p><p>h�ten will, so ziehe ich doch in Zweifelsf�llen die Unwahrheit der L�ge </p><p>vor, weil ich Tugend h�her sch�tze als Klugheit. Freilich w�re dieser </p><p>Schaden leicht zu heilen, wenn Du Raphael selbst m�ndlich oder </p><p>schriftlich fragen wolltest. Das mu�t Du sowieso tun wegen eines anderen </p><p>Bedenkens, das uns gekommen ist, ich wei� nicht, ob mehr durch meine </p><p>oder Deine oder Raphaels eigene Schuld. Denn weder ist es uns in den </p><p>Sinn gekommen, danach zu fragen, noch ihm, es uns zu sagen, in welcher </p><p>Gegend jenes neuen Erdteils Utopia liegt. Wahrhaftig, wie gern w�rde ich </p><p>mit etwas Geld von mir diese Unterlassung ungeschehen machen! Denn </p><p>erstens sch�me ich mich ein wenig, nicht zu wissen, in welchem Meere die </p><p>Insel liegt, von der ich so viel zu berichten wei�; sodann aber gibt es </p><p>bei uns den einen und den anderen, vor allem aber einen frommen </p><p>Theologen von Beruf, der darauf brennt, Utopia zu besuchen, nicht aus </p><p>eitlem und neugierigem Verlangen, Neues zu sehen, sondern um die </p><p>verhei�ungsvollen Keime unserer Religion dort zu pflegen und noch zu </p><p>vermehren. Um dabei ordnungsgem�� zu verfahren, hat er beschlossen, sich </p><p>vorher einen Missionsauftrag vom Papste zu verschaffen und sich von den </p><p>Utopiern sogar zum Bischof w�hlen zu lassen. Dabei st�rt es ihn durchaus </p><p>nicht, da� er sich um dieses Vorsteheramt erst bewerben m��te. </p><p>Allerdings ist sein Ehrgeiz, wie er meint, deshalb gottgef�llig, weil er </p><p>nicht durch R�cksicht auf Ehre oder Gewinn, sondern durch R�cksicht auf </p><p>die Religion bedingt ist. </p><p>Deshalb wende Dich, mein Peter, ich bitte Dich darum, entweder m�ndlich, </p><p>wenn es Dir ohne Umst�nde m�glich ist, oder brieflich an Hythlodeus und </p><p>sorge daf�r, da� in diesem meinen Werke nichts Falsches steht oder</p><p>nichts Wahres vermi�t wird. Und vielleicht ist es besser, ihm das Buch </p><p>selbst zu zeigen. Einerseits n�mlich ist niemand anders ebenso imstande, </p><p>einen etwaigen Irrtum zu berichtigen, anderseits kann er das selbst auch </p><p>nur, wenn er durchliest, was ich geschrieben habe. Au�erdem wirst Du auf </p><p>diese Weise merken, ob er damit einverstanden ist, da� ich dieses Buch </p><p>schreibe, oder ob er �rgerlich dar�ber ist. Falls er sich n�mlich </p><p>vorgenommen hat, seine Abenteuer selbst aufzuzeichnen, so m�chte er </p><p>vielleicht nicht -- und ich bestimmt auch nicht�--, da� ich ihm Duft und </p><p>Reiz seiner Erz�hlung im voraus wegnehme, indem ich den Staat Utopia </p><p>allgemein bekanntwerden lasse. Allerdings bin ich, wenn ich ganz offen </p><p>sein soll, auch mir selber noch nicht recht im klaren, ob ich das Buch </p><p>�berhaupt erscheinen lasse. Denn der Geschmack der Menschen ist so </p><p>verschieden, und manche sind so eigensinnig, so undankbar und so </p><p>unsinnig in ihrem Urteil, da� offenbar die Leute viel gl�cklicher sind, </p><p>die in Freude und Frohsinn ihr eigenes Ich befriedigen, als diejenigen, </p><p>die sich zerm�rben in dem Bestreben, etwas zu ver�ffentlichen, was f�r </p><p>andere, die w�hlerisch oder undankbar sind, ein Nutzen oder ein </p><p>Vergn�gen sein k�nnte. Die meisten haben keinen Sinn f�r literarische </p><p>Dinge; viele verachten sie; ein Barbar lehnt alles als schwer ab, was </p><p>nicht g�nzlich barbarisch ist; gelehrte Pedanten verschm�hen alles als </p><p>abgegriffen, was nicht von veralteten Ausdr�cken strotzt; manchen </p><p>gef�llt nur das Alte, den meisten nur das eigene Wissen. Dieser ist so </p><p>m�rrisch, da� er von Scherzen nichts wissen will, dieser wieder so fade, </p><p>da� er keine Witze vertr�gt; manche sind so plattnasig, da� sie jedes </p><p>Naser�mpfen scheuen wie ein von einem tollen Hund Gebissener das Wasser, </p><p>andere wieder sind so wetterwendisch, da� sie im Sitzen etwas anderes </p><p>gelten lassen als im Stehen. Manche sitzen in den Kneipen, urteilen am </p><p>Biertisch �ber die Talente der Schriftsteller und verurteilen sie mit </p><p>gro�em Nachdruck, ganz wie es ihnen beliebt, indem sie einen jeden in </p><p>seinen Schriften gleichsam beim Schopfe nehmen und ihn zausen, wobei sie </p><p>selbst aber vor der Hand in Sicherheit und, wie man so sagt, weit vom </p><p>Schu� sind. Denn rundum sind sie so glatt und kahlgeschoren, da� sie </p><p>auch nicht ein H�rchen eines guten Mannes an sich haben, an dem man sie </p><p>fassen k�nnte. Ferner gibt es Leute, die so undankbar sind, da� sie sich </p><p>zwar ausgiebig an einem Werke erg�tzen, dem Verfasser aber trotzdem </p><p>keine gr��ere Liebe entgegenbringen. Sie �hneln den unh�flichen G�sten, </p><p>die sich mit einem �ppigen Mahle bewirten lassen und dann ges�ttigt </p><p>heimgehen, ohne dem, der sie eingeladen hat, ein Wort des Dankes zu </p><p>sagen. Nun geh hin und richte f�r Leute mit so verw�hntem Gaumen, von so </p><p>verschiedenem Geschmack und noch dazu von so dankbarer und lieber </p><p>Gesinnung auf Deine eigenen Kosten ein Mahl her! </p><p>Aber gleichwohl, mein Peter, besprich, was ich Dir gesagt habe, mit </p><p>Hythlodeus! Sp�ter aber kann man sich ja diese Frage der </p><p>Ver�ffentlichung noch einmal �berlegen. Sollte er indessen nichts </p><p>dagegen haben, so will ich bei dem, was die Herausgabe noch erfordert, </p><p>dem Rate meiner Freunde folgen und vor allem Deinem, da ich nun einmal </p><p>die M�he des Schreibens hinter mir habe und jetzt erst versp�tet zur </p><p>Einsicht komme. Lebe wohl, mein liebster Peter �gid, nebst Deiner guten </p><p>Frau und behalte mich auch weiterhin lieb, da ja auch ich Dich noch </p><p>lieber habe, als es sonst meine Gewohnheit ist! </p><p>ERSTES BUCH </p><p>Rede des trefflichen Raphael Hythlodeus �ber den besten Zustand des </p><p>Staates, ver�ffentlicht von dem erlauchten Thomas Morus, B�rger und</p><p>Vicecomes der r�hmlich bekannten britischen Hauptstadt London. </p><p>K�rzlich hatte der siegreiche K�nig von England Heinrich, der achte </p><p>dieses Namens, ein mit allen Tugenden eines hervorragenden F�rsten </p><p>gezierter Herrscher, einige nicht belanglose Meinungsverschiedenheiten </p><p>mit Karl, dem erhabenen K�nig von Kastilien. Zu den Verhandlungen </p><p>dar�ber und zur Beilegung dieser Streitigkeiten schickte mich K�nig </p><p>Heinrich als Abgesandten nach Flandern, und zwar zusammen mit dem </p><p>unvergleichlichen Cuthbert Tunstall, den der K�nig erst k�rzlich unter </p><p>�beraus starkem und allgemeinem Beifall mit dem Amte des Archivars </p><p>betraut hat. �ber seine Vorz�ge will ich nichts sagen, nicht als ob ich </p><p>f�rchtete, infolge unserer Freundschaft k�nnte mein Urteil zu wenig den </p><p>Tatsachen entsprechen, sondern weil seine T�chtigkeit und Gelehrsamkeit </p><p>gr��er ist, als ich sie r�hmen k�nnte, und au�erdem �berall bekannter </p><p>und ber�hmter, als da� sie noch ger�hmt zu werden brauchte, ich m��te </p><p>denn, wie man sagt, die Sonne mit der Laterne zeigen wollen. In Br�gge </p><p>trafen wir -- so war es verabredet -- die Beauftragten des K�nigs Karl, </p><p>alles treffliche M�nner. Unter ihnen befand sich der Pr�fekt von Br�gge, </p><p>ein hochangesehener Mann, der F�hrer und das Haupt der Abordnung; ihr </p><p>Sprecher und ihre Seele jedoch war Georg Temsicius, der Propst von </p><p>Cassel, ein Redner von einer nicht nur erworbenen, sondern auch </p><p>angeborenen Beredsamkeit, au�erdem ein �beraus erfahrener Jurist und im </p><p>Verhandeln ein vortrefflicher Meister durch seine Begabung und </p><p>best�ndige Praxis. Ein und das andere Mal kamen wir zusammen, ohne in </p><p>gewissen Fragen eine rechte Einigung zu erzielen. Da verabschiedeten </p><p>sich die anderen f�r einige Tage von uns und reisten nach Br�ssel, um </p><p>sich bei ihrem F�rsten Bescheid zu holen. Inzwischen begab ich mich -- </p><p>die Gesch�fte brachten es so mit sich -- nach Antwerpen. W�hrend meines </p><p>Aufenthaltes dort kam h�ufig au�er anderen, aber immer als liebster </p><p>Besucher, Peter �gid aus Antwerpen zu mir. Er genie�t gro�es Vertrauen </p><p>bei seinen Landsleuten und nimmt eine angesehene Stellung ein, verdient </p><p>aber die angesehenste. Man wei� n�mlich nicht, wodurch sich der junge </p><p>Mann mehr auszeichnet, ob durch seine Bildung oder seinen Charakter; ist </p><p>er doch ein sehr guter Mensch und zugleich ein gro�er Gelehrter, </p><p>au�erdem ein Mann von lauterer Gesinnung gegen alle, seinen Freunden </p><p>gegen�ber aber von solcher Herzlichkeit, Liebe, Treue und aufrichtigen </p><p>Neigung, da� man kaum einen oder den anderen irgendwo findet, den man </p><p>als einen ihm in jeder Beziehung gleichwertigen Freund bezeichnen </p><p>m�chte. Er besitzt eine seltene Bescheidenheit; niemandem liegt </p><p>Verstellung so fern wie ihm; niemand ist schlichter und zugleich </p><p>kl�ger. Ferner kann er sich so gef�llig und harmlos-witzig unterhalten, </p><p>da� der so angenehme Umgang und die so liebe Plauderei mit ihm zu einem </p><p>gro�en Teile mich die Sehnsucht nach der Heimat und dem heimischen Herd, </p><p>nach meiner Frau und meinen Kindern leichter ertragen lie�; denn schon </p><p>damals war ich �ber vier Monate von daheim fort, und in �beraus </p><p>be�ngstigender Weise qu�lte mich das Verlangen, sie wiederzusehen. </p><p>Eines Tages hatte ich in der wundersch�nen und vielbesuchten </p><p>Liebfrauenkirche am Gottesdienst teilgenommen und schickte mich an, nach </p><p>Beendigung der Feier von dort in meine Herberge zur�ckzukehren, da sehe </p><p>ich Peter zuf�llig sich mit einem Fremden unterhalten, einem �lteren </p><p>Manne mit sonnverbranntem Gesicht und langem Bart. Der Mantel hing ihm </p><p>nachl�ssig von der Schulter herab, und seinem Aussehen und seiner </p><p>Kleidung nach war er ein Seemann. Sobald mich Peter erblickte, kam er </p><p>auf mich zu und gr��te. Als ich antworten wollte, nahm er mich ein wenig </p><p>beiseite und fragte: �Siehst du den da?� Dabei zeigte er auf den, mit </p><p>dem ich ihn hatte sprechen sehen. �Den wollte ich gerade jetzt zu dir </p><p>bringen.� -- �Er w�re mir sehr willkommen gewesen�, antwortete ich, �und</p><p>zwar deinetwegen.� -- �Nein�, sagte er, �vielmehr seinetwegen, wenn du </p><p>den Mann nur schon kenntest. Denn niemand in der ganzen Welt kann dir </p><p>heutzutage so viel von unbekannten Menschen und L�ndern erz�hlen, und, </p><p>wie ich wei�, bist du ja ganz versessen darauf, so etwas zu h�ren.� -- </p><p>�Also war meine Vermutung�, sagte ich, �gar nicht so falsch. Denn gleich </p><p>auf den ersten Blick habe ich ihn als Seemann erkannt.� -- �Und doch </p><p>hast du dich stark geirrt; er f�hrt wenigstens nicht als Palinurus, </p><p>sondern als Odysseus oder vielmehr als Plato. Denn dieser Raphael -- so </p><p>hei�t er n�mlich, und sein Familienname ist Hythlodeus -- ist nicht </p><p>wenig bewandert im Lateinischen und sehr bewandert im Griechischen, und </p><p>zwar hat er die griechische Sprache deshalb mehr getrieben als die der </p><p>R�mer, weil er sich ganz der Philosophie gewidmet und erkannt hatte, da� </p><p>auf dem Gebiete der Philosophie im Lateinischen nichts von irgendwelcher </p><p>Bedeutung vorhanden ist au�er einigem von Seneca und Cicero. Dann </p><p>�berlie� er sein vom Vater ererbtes Gut, in dem er wohnte, seinen </p><p>Br�dern, schlo� sich -- er ist n�mlich Portugiese -- dem Amerigo </p><p>Vespucci an, um sich die Welt anzusehen, und war dessen st�ndiger </p><p>Begleiter auf den drei letzten seiner vier Seereisen, die man schon hier </p><p>und da gedruckt lesen kann. Von der letzten jedoch kehrte er nicht mit </p><p>ihm zur�ck. Er bem�hte sich vielmehr darum und erpre�te von Amerigo die </p><p>Erlaubnis, zu jenen vierundzwanzig zu geh�ren, die am Ende der letzten </p><p>Seereise in einem Kastell zur�ckgelassen wurden. So blieb er denn dort </p><p>zur�ck, entsprechend seiner Sinnesart, die mehr nach einem Aufenthalte </p><p>in fremdem Lande als nach einem Grabmale verlangt. F�hrt er doch dauernd </p><p>solche Spr�che im Munde wie 'Unter dem Himmelsgew�lbe ruht, wer keine </p><p>Urne hat' und 'Zum Himmel ist es von �berall her gleich weit'. Dieser </p><p>Wagemut w�re ihm ohne Gottes gn�digen Beistand nur allzu teuer zu stehen </p><p>gekommen. Nach Vespuccis Abreise durchstreifte er dann zusammen mit f�nf </p><p>Kameraden aus dem Kastell zahlreiche L�nder und gelangte schlie�lich </p><p>durch einen wunderbaren Zufall nach Taprobane und von dort nach </p><p>Caliquit. Hier hatte er das Gl�ck, portugiesische Schiffe anzutreffen, </p><p>auf denen er schlie�lich wider Erwarten heimkehrte.� </p><p>Als Peter mit seiner Erz�hlung fertig war, dankte ich ihm f�r seine </p><p>Gef�lligkeit und seine Bem�hungen, mir die Unterhaltung mit einem Manne </p><p>zu erm�glichen, die mir seiner Meinung nach willkommen war, und wandte </p><p>mich Raphael zu. Wir begr��ten einander, wechselten jene bei der ersten </p><p>Begegnung mit Fremden allgemein �blichen Redensarten und gingen dann in </p><p>meine Wohnung. Hier setzten wir uns im Garten auf eine Rasenbank und </p><p>fingen an, miteinander zu plaudern. </p><p>Da erz�hlte uns denn Raphael, wie er es zusammen mit seinen im Kastell </p><p>zur�ckgebliebenen Kameraden nach Vespuccis Abreise angestellt habe, </p><p>durch Freundlichkeiten und Schmeicheleien allm�hlich die Zuneigung der </p><p>Eingeborenen zu gewinnen, nicht nur ohne Gefahr, sondern auch in </p><p>Freundschaft unter ihnen zu leben und damit auch noch die Gunst und </p><p>Wertsch�tzung eines F�rsten -- sein und seines Landes Name sei ihm </p><p>entfallen -- zu erlangen. In seiner Freigebigkeit -- so erz�hlte er </p><p>weiter -- versah dieser ihn und f�nf seiner Kameraden reichlich mit </p><p>Lebensmitteln und Geld f�r eine Expedition, die sie dann zu Wasser mit </p><p>Fahrzeugen und zu Lande mit Wagen unternahmen und auf der sie ein h�chst </p><p>zuverl�ssiger F�hrer zu anderen F�rsten geleitete, an die sie warme </p><p>Empfehlungsschreiben mithatten. Dann gelangten sie nach einer Reise von </p><p>vielen Tagen zu festen Pl�tzen, St�dten und gar nicht schlecht </p><p>eingerichteten volkreichen Staaten. Zwar liegen unter dem �quator, wie </p><p>Raphael erz�hlte, und von da aus auf beiden Seiten etwa bis zur Grenze </p><p>der Sonnenbahn w�ste und der d�rrenden Sonnenglut dauernd ausgesetzte </p><p>Ein�den: Unwirtlichkeit ringsum und ein trostloser Anblick, abschreckend </p><p>alles und unkultiviert, Schlupfwinkel von wilden Tieren und Schlangen</p><p>oder schlie�lich auch von Menschen, die Bestien weder an Wildheit noch </p><p>an Gef�hrlichkeit nachstehen. F�hrt man aber weiter, so wird alles </p><p>allm�hlich milder: das Klima weniger rauh, die Erde von einladendem Gr�n </p><p>schimmernd, zahmer die Natur der Lebewesen. Endlich bekommt man </p><p>Menschen, St�dte und feste Pl�tze zu Gesicht, und unter ihnen herrscht </p><p>ein ununterbrochener Handelsverkehr, nicht nur untereinander und mit den </p><p>Nachbarn, sondern auch mit fernen V�lkern, und zwar zu Wasser und zu </p><p>Lande. </p><p>Dadurch bot sich f�r Raphael die Gelegenheit, viele L�nder diesseits und </p><p>jenseits des Meeres zu besuchen; denn jedes Schiff, das ausger�stet </p><p>wurde, nahm ihn und seine Begleiter sehr gern mit. Wie er erz�hlte, </p><p>hatten die Schiffe, die sie in den ersten L�ndern zu sehen bekamen, </p><p>flache Kiele und Segel aus zusammengen�hten Papyrusbl�ttern oder aus </p><p>Weidengeflecht, anderswo auch aus H�uten. Auf der Weiterfahrt begegneten </p><p>sie Schiffen mit spitzgeschn�belten Kielen und Segeln aus Hanf; am Ende </p><p>war alles so wie bei uns. Die Seeleute waren nicht unerfahren in Meeres- </p><p>und Himmelskunde. Aber einen au�erordentlichen Dank erntete Raphael </p><p>daf�r, da� er sie im Gebrauch des Kompasses unterwies, den sie bis dahin </p><p>�berhaupt noch nicht kannten. Deshalb hatten sie sich auch nur zaghaft </p><p>ans Meer gew�hnt und vertrauten sich ihm nicht ohne Grund nur im Sommer </p><p>an. Jetzt aber achten die Seeleute im Vertrauen auf den Magnetstein die </p><p>Gefahren des Winters gering, allerdings mehr sorglos als gefahrlos. </p><p>Daher besteht die Gefahr, diese Erfindung, die ihnen, wie man glaubte, </p><p>gro�en Vorteil bringen werde, k�nne infolge ihrer Unvorsichtigkeit gro�e </p><p>Sch�den verursachen. </p><p>Was Raphael an den einzelnen Orten, wie er erz�hlte, gesehen hat, das </p><p>alles hier mitzuteilen, w�rde zu weit f�hren und ist auch nicht der </p><p>Zweck dieses Buches. Vielleicht werde ich es einmal an anderer Stelle </p><p>erz�hlen, besonders alles das, dessen Kenntnis von Nutzen ist, wie z.�B. </p><p>in erster Linie die richtigen und klugen politischen Ma�nahmen, die er </p><p>bei gesitteten V�lkern wahrgenommen hat. In betreff dieser Dinge </p><p>befragten wir ihn n�mlich am meisten, und �ber sie sprach er auch am </p><p>liebsten, w�hrend wir es vorl�ufig unterlie�en, uns nach Ungeheuern zu </p><p>erkundigen, dem Langweiligsten, das es gibt. Denn Scyllen und </p><p>r�uberische Cel�nonen, menschenfressende L�strygonen und dergleichen </p><p>abscheuliche Ungeheuer sind fast �berall zu finden, aber B�rger, die in </p><p>einem vern�nftig und weise geleiteten Staate leben, wohl nirgends. Wenn </p><p>er nun aber auch bei jenen unbekannten V�lkern viele verkehrte </p><p>Einrichtungen wahrgenommen hat, so hat er doch auch nicht weniges </p><p>aufgez�hlt, was als Beispiel dienen kann, die Fehler unserer St�dte, </p><p>Nationen, V�lker und Herrschaften zu verbessern, und wor�ber ich, wie </p><p>gesagt, an anderer Stelle einmal sprechen mu�. Jetzt will ich nur seinen </p><p>Bericht �ber Sitten und Einrichtungen der Utopier wiedergeben, wobei </p><p>ich jedoch das Gespr�ch vorausschicke, in dessen Verlauf ihn eine </p><p>Wendung dazu veranla�te, diesen Staat zu erw�hnen. </p><p>Mit gro�er Klugheit hatte Raphael aufgez�hlt, was hier und dort falsch </p><p>war -- sicherlich war es sehr viel auf beiden Seiten des Ozeans�--, dann </p><p>aber auch, welche Ma�nahmen bei uns und ebenso bei jenen anderen </p><p>verst�ndiger sind. Er hatte n�mlich Sitten und Einrichtungen eines jeden </p><p>Volkes so fest im Ged�chtnis, als h�tte er an jedem von ihm besuchten </p><p>Orte sein ganzes Leben zugebracht. Da staunte Peter und meinte: �Ich mu� </p><p>mich in der Tat wundern, mein Raphael, da� du nicht in die Dienste eines </p><p>K�nigs trittst; denn das wei� ich zur Gen�ge: es gibt keinen, dem du </p><p>nicht sehr willkommen w�rest, da du es mit diesem deinen Wissen und </p><p>dieser deiner Kenntnis von Gegenden und Menschen verstehst, ihn nicht </p><p>blo� zu unterhalten, sondern auch durch Beispiele zu belehren und ihm</p><p>mit deinem Rat zu helfen. Auf diese Weise k�nntest du f�r dich selbst </p><p>ausgezeichnet sorgen und zugleich allen deinen Angeh�rigen sehr n�tzen.� </p><p>�Was meine Angeh�rigen betrifft�, erwiderte Raphael, �so k�mmern die </p><p>mich wenig; ihnen gegen�ber habe ich n�mlich, wie ich glaube, meine </p><p>Pflicht so ziemlich erf�llt. Denn was andere erst, wenn sie alt und </p><p>krank sind, abtreten, ja sogar auch dann nur ungern, wenn sie es nicht </p><p>l�nger behalten k�nnen, das habe ich unter meine Verwandten und Freunde </p><p>verteilt, und zwar zu einer Zeit, da ich nicht mehr blo� gesund und </p><p>frisch war, sondern sogar schon in jungen Tagen. Sie m��ten also, meine </p><p>ich, mit meiner Freigebigkeit eigentlich zufrieden sein und d�rften </p><p>nicht au�erdem noch verlangen und erwarten, da� ich mich ihretwegen </p><p>einem K�nig als Knecht verdinge.� </p><p>�Halt!� sagte da Peter. �Ich meinte, du solltest nicht ein Knecht, </p><p>sondern ein Diener von K�nigen werden.� </p><p>�Das ist nur ein ganz kleiner Unterschied�, antwortete Raphael. </p><p>�Wie du die Sache auch nennen magst�, sagte da Peter, �ich bin </p><p>jedenfalls der Ansicht, da� das der Weg ist, nicht nur anderen in </p><p>pers�nlichem und �ffentlichem Interesse zu n�tzen, sondern auch deine </p><p>eigene Lage gl�cklicher zu gestalten.� </p><p>�Gl�cklicher? auf einem Wege, vor dem mir graut?� fragte Raphael. �Jetzt </p><p>lebe ich, ganz wie es mir beliebt, und das ist, wie ich sicher vermute, </p><p>bei den wenigsten F�rstendienern der Fall. Es gibt ja auch genug Leute, </p><p>die sich um die Freundschaft der M�chtigen bem�hen. Da sollte man es </p><p>nicht f�r einen gro�en Verlust halten, wenn diese auf mich und den einen </p><p>oder den anderen meinesgleichen verzichten m�ssen.� </p><p>�Es ist klar, mein Raphael�, erwiderte ich, �da� du weder nach Reichtum </p><p>noch nach Macht verlangst. Und f�rwahr, einen Mann von dieser deiner </p><p>Gesinnung verehre und achte ich nicht weniger als irgendeinen der </p><p>M�chtigsten. Indessen wirst du, wie mir scheint, durchaus deiner selbst </p><p>und deiner edlen Gesinnung, ja eines wahren Philosophen w�rdig handeln, </p><p>wenn du es fertig br�chtest, selbst unter Verzicht auf etwas pers�nliche </p><p>Bequemlichkeit, deine Begabung und deinen Eifer dem Wohle des </p><p>Gemeinwesens zu widmen. Das k�nntest du aber niemals mit so gro�em </p><p>Erfolge tun, als wenn du zum Rate eines gro�en F�rsten geh�rtest und ihm </p><p>richtige und gute Ratschl�ge erteiltest, und das w�rdest du ja, wie ich </p><p>sicher wei�, tun. Denn ein F�rst ist gleichsam ein nie versiegender </p><p>Quell, von dem sich ein Sturzbach alles Guten und B�sen auf das ganze </p><p>Volk ergie�t. Dein theoretisches Wissen aber ist so vollkommen, da� du </p><p>gar keine gro�e praktische Erfahrung n�tig hast, und deine </p><p>Lebenserfahrung anderseits so gro�, da� du gar kein theoretisches Wissen </p><p>brauchst, um einen ausgezeichneten Ratgeber jedes beliebigen K�nigs </p><p>abzugeben.� </p><p>�Da befindest du dich in einem doppelten Irrtum, mein lieber Morus�, </p><p>erwiderte Raphael, �einmal hinsichtlich meiner und sodann hinsichtlich </p><p>der Sache selbst. Ich besitze n�mlich gar nicht die F�higkeit, die du </p><p>mir zuschreibst, und auch wenn ich sie im h�chsten Grade bes��e, w�rde </p><p>ich doch selbst durch den Verzicht auf meine Mu�e den Interessen des </p><p>Staates in keinerlei Weise dienen. Erstens n�mlich besch�ftigen sich die </p><p>F�rsten selbst alle zumeist lieber mit milit�rischen Dingen, von denen </p><p>ich nichts verstehe und auch nichts verstehen m�chte, als mit den </p><p>segensreichen K�nsten des Friedens, und weit gr��er ist ihr Eifer, sich </p><p>durch Recht oder Unrecht neue Reiche zu erwerben als die schon</p><p>erworbenen gut zu verwalten. Ferner ist von allen Ratgebern der K�nige </p><p>jeder entweder in Wahrheit so weise, da� er den Rat eines anderen nicht </p><p>braucht, oder er d�nkt sich so weise, da� er ihn nicht guthei�en mag. </p><p>Dabei pflichten sie unter schmarotzerischen Schmeicheleien den </p><p>ungereimtesten �u�erungen derer bei, die bei dem F�rsten in h�chster </p><p>Gunst stehen und die sie sich deshalb durch ihre Zustimmung </p><p>verpflichten wollen. Und gewi� ist es ganz nat�rlich, da� einem jeden </p><p>seine eigenen Einf�lle zusagen. So findet der Rabe ebenso wie der Affe </p><p>am eigenen Jungen seinen Gefallen. Wenn aber jemand im Kreise jener </p><p>Leute, die auf fremde Meinungen eifers�chtig sind oder die eigenen </p><p>vorziehen, etwas vorbringen sollte, das, wie er gelesen hat, zu anderer </p><p>Zeit vorgekommen ist oder das er anderswo gesehen hat, so benehmen sich </p><p>die Zuh�rer gerade so, als ob der ganze Ruf ihrer Weisheit gef�hrdet </p><p>w�re und als ob man sie danach f�r Narren halten m��te, wenn sie nicht </p><p>imstande sind, etwas zu finden, was sie an dem von den anderen </p><p>Gefundenen schlecht machen k�nnen. Wenn sie keinen anderen Ausweg </p><p>wissen, so nehmen sie ihre Zuflucht zu Redensarten wie: So hat es </p><p>unseren Vorfahren gefallen; w�ren wir doch ebenso klug wie sie! Und nach </p><p>einem solchen Ausspruch setzen sie sich hin, als h�tten sie damit die </p><p>Sache v�llig und trefflich erledigt. Gerade als ob es eine gro�e Gefahr </p><p>bedeutete, wenn sich jemand dabei ertappen l��t, in irgend etwas </p><p>gescheiter zu sein als seine Vorfahren! Und doch lassen wir alle ihre </p><p>guten Einrichtungen mit gro�em Gleichmut gelten; wenn sie aber bei </p><p>irgend etwas h�tten kl�ger zu Werke gehen k�nnen, so ergreifen wir </p><p>sofort gierig diese Gelegenheit und halten hartn�ckig daran fest. Das </p><p>ist auch die Quelle dieser hochm�tigen, sinnlosen und eigensinnigen </p><p>Urteile, auf die ich schon oft gesto�en bin, besonders aber auch einmal </p><p>in England.� </p><p>�H�r einmal!� rief ich da, �du bist auch bei uns gewesen?� </p><p>�Allerdings�, antwortete er, �und zwar habe ich mich dort einige Monate </p><p>aufgehalten, nicht lange nach jener Niederlage, die den B�rgerkrieg </p><p>Westenglands gegen den K�nig durch eine beklagenswerte Niedermetzelung </p><p>der Aufst�ndischen gewaltsam beendete. In jener Zeit hatte ich dem </p><p>ehrw�rdigen Vater Johannes Morton, dem Erzbischof von Canterbury, </p><p>Kardinal und damals auch noch Lordkanzler von England, viel zu danken, </p><p>einem Manne, lieber Peter -- dem Morus erz�hle ich damit nichts </p><p>Neues�--, den man nicht weniger wegen seiner Klugheit und T�chtigkeit </p><p>als wegen seines Ansehens verehren mu�. Er war von mittlerer Statur, </p><p>sein R�cken war von seinem, wenn auch hohen Alter noch nicht gebeugt; </p><p>seine Miene fl��te Ehrfurcht, nicht Scheu ein. Im Verkehr war er nicht </p><p>unzug�nglich, aber doch ernst und w�rdevoll. Er fand ein Vergn�gen </p><p>daran, Bittsteller bisweilen etwas schroffer anzureden, aber nicht etwa </p><p>in b�ser Absicht, sondern um die Sinnesart und Geistesgegenwart eines </p><p>jeden auf die Probe zu stellen. �ber letztere Eigenschaft, die ihm ja </p><p>selber gleichsam angeboren war, freute er sich stets, wofern keine </p><p>Unversch�mtheit damit verbunden war, und sie sch�tzte er als geeignet zu </p><p>der F�hrung der Gesch�fte. Seine Rede zeugte von feiner Bildung und </p><p>Energie; seine Rechtserfahrung war gro�, seine Begabung unvergleichlich, </p><p>sein Ged�chtnis geradezu fabelhaft stark. Diese ausgezeichneten </p><p>Naturanlagen vervollkommnete er noch durch Studium und �bung. Seinen </p><p>Ratschl�gen schenkte der K�nig, wie es schien, w�hrend meiner </p><p>Anwesenheit das gr��te Vertrauen, und sie waren eine starke St�tze f�r </p><p>den Staat. Denn in fr�hester Jugend und gleich von der Schule weg an </p><p>den Hof gebracht, war er sein ganzes Leben lang in den wichtigsten </p><p>Gesch�ften t�tig gewesen und von mannigfachen Schicksalsst�rmen </p><p>best�ndig hin und her geworfen worden, und dadurch hatte er sich unter </p><p>vielen gro�en Gefahren eine Lebensklugheit erworben, die nur schwer</p><p>wieder verlorengeht, wenn sie auf diese Weise gewonnen wird. </p><p>Als ich eines Tages an seiner Tafel sa�, wollte es der Zufall, da� einer </p><p>von euren Laienjuristen zugegen war. Dieser begann -- ich wei� nicht, </p><p>wie er darauf kam�--, eifrig jene strenge Justiz zu loben, die man </p><p>damals in England Dieben gegen�ber �bte. Wie er erz�hlte, wurden </p><p>allenthalben bisweilen zwanzig an _einem_ Galgen aufgeh�ngt. Da nur sehr </p><p>wenige der Todesstrafe entgingen, wundere er sich, so meinte er, um so </p><p>mehr, welch widriges Geschick daran schuld sei, da� sich trotzdem noch </p><p>�berall so viele herumtrieben. Da sagte ich -- vor dem Kardinal wagte </p><p>ich es n�mlich, offen meine Meinung zu �u�ern�--: �Da brauchst du dich </p><p>gar nicht zu wundern; denn diese Bestrafung der Diebe geht �ber das, was </p><p>gerecht ist, hinaus und liegt nicht im Interesse des Staates. </p><p>Als S�hne f�r Diebst�hle ist die Todesstrafe n�mlich zu grausam, und, um </p><p>vom Stehlen abzuschrecken, ist sie trotzdem unzureichend. Denn </p><p>einerseits ist einfacher Diebstahl doch kein so schlimmes Verbrechen, </p><p>da� es mit dem Tode geb��t werden m��te, anderseits aber gibt es keine </p><p>so harte Strafe, diejenigen von R�ubereien abzuhalten, die kein anderes </p><p>Gewerbe haben, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Wie mir daher </p><p>scheint, folgt ihr in dieser Sache -- wie ein guter Teil der Menschheit </p><p>�brigens auch -- dem Beispiel der schlechten Lehrer, die ihre Sch�ler </p><p>lieber pr�geln als belehren. So verh�ngt man harte und entsetzliche </p><p>Strafen �ber Diebe, w�hrend man viel eher daf�r h�tte sorgen sollen, da� </p><p>sie ihren Unterhalt haben, damit sich niemand der grausigen </p><p>Notwendigkeit ausgesetzt sieht, erst zu stehlen und dann zu sterben.� </p><p>�Daf�r ist ja doch zur Gen�ge gesorgt�, erwiderte er. �Wir haben ja das </p><p>Handwerk und den Ackerbau. Beides w�rde sie ern�hren, wenn sie nicht aus </p><p>freien St�cken lieber Gauner sein _wollten_.� </p><p>�Halt, so entschl�pfst du mir nicht!� antwortete ich. �Zun�chst wollen </p><p>wir nicht von denen reden, die, wie es h�ufig vorkommt, aus inneren oder </p><p>ausw�rtigen Kriegen als Kr�ppel heimkehren wie vor einer Reihe von </p><p>Jahren aus der Schlacht gegen die Cornwaller und unl�ngst aus dem Kriege </p><p>mit Frankreich. F�r den Staat oder f�r den K�nig opfern sie ihre </p><p>gesunden Glieder und sind nun zu gebrechlich, um ihren alten Beruf </p><p>wieder auszu�ben, und zu alt, um sich f�r einen neuen auszubilden. Diese </p><p>Leute wollen wir also, wie gesagt, beiseite lassen, da es nur von Zeit </p><p>zu Zeit zu einem Kriege kommt, und betrachten wir nur das, was </p><p>tagt�glich geschieht! </p><p>Da ist zun�chst die so gro�e Zahl der Edelleute. Selber m��ig, leben sie </p><p>wie die Drohnen von der Arbeit anderer, n�mlich von der der Bauern auf </p><p>ihren G�tern, die sie bis aufs Blut aussaugen, um ihre pers�nlichen </p><p>Eink�nfte zu erh�hen. Das ist n�mlich die einzige Art von </p><p>Wirtschaftlichkeit, die jene Menschen kennen; im �brigen sind sie </p><p>Verschwender, und sollten sie auch bettelarm dadurch werden. Au�erdem </p><p>aber scharen sie einen gewaltigen Schwarm von Tagedieben um sich, die </p><p>niemals ein Handwerk gelernt haben, mit dem sie sich ihr Brot verdienen </p><p>k�nnten. Diese Leute wirft man sofort auf die Stra�e, sobald der </p><p>Hausherr stirbt oder sie selbst krank werden; denn lieber f�ttert man </p><p>Faulenzer durch als Kranke, und oft ist auch der Erbe gar nicht in der </p><p>Lage, die v�terliche Dienerschaft weiter zu halten. Inzwischen leiden </p><p>jene Menschen tapfer Hunger oder treiben tapfer Stra�enraub. Was sollten </p><p>sie denn sonst auch tun? Haben n�mlich erst einmal ihre Kleider und ihre </p><p>Gesundheit durch das Herumstrolchen auch nur ein wenig gelitten, so mag </p><p>sie, die infolge ihrer Krankheit von Schmutz starren und in Lumpen </p><p>geh�llt sind, kein Edelmann mehr in Dienst nehmen. Aber auch die Bauern</p><p>getrauen es sich nicht; denn sie wissen ganz genau: einer, der in </p><p>Nichtstun und genie�erischem Leben gro� geworden und gewohnt ist, mit </p><p>Schwert und Schild einherzustolzieren, mit von Eitelkeit umnebelter </p><p>Miene auf seine gesamte Umgebung herabzublicken und jedermann im </p><p>Vergleich mit sich zu verachten, eignet sich keineswegs dazu, einem </p><p>armen Manne mit Hacke und Spaten f�r geringen Lohn und karge Kost treu </p><p>zu dienen.� </p><p>�Und doch m�ssen wir gerade diese Menschenklasse ganz besonders hegen </p><p>und pflegen�, erwiderte der Rechtsgelehrte. �Denn gerade auf diesen </p><p>M�nnern, die mehr Mut und Edelsinn besitzen als Handwerker und </p><p>Landleute, beruht die Kraft und St�rke unseres Heeres, wenn es einmal </p><p>n�tig ist, sich im Felde zu schlagen.� </p><p>�In der Tat�, antwortete ich, �ebenso gut k�nntest du sagen, um des </p><p>Krieges willen m�sse man die Diebe hegen und pflegen; denn an ihnen wird </p><p>es euch ganz gewi� nie fehlen, solange ihr diese Menschenklasse noch </p><p>habt. Und gewi�, R�uber sind keine feigen Soldaten und die Soldaten </p><p>nicht die feigsten unter den R�ubern: so gut passen diese Berufe </p><p>zueinander. Indessen ist diese weitverbreitete Plage keine </p><p>Eigent�mlichkeit eures Volkes; sie ist n�mlich fast allen V�lkern </p><p>gemeinsam. Frankreich z.�B. sucht eine noch andere, verderblichere Pest </p><p>heim: das ganze Land ist auch im Frieden -- wenn jener Zustand �berhaupt </p><p>Frieden ist -- von S�ldnern �berschwemmt und bedr�ngt. Sie sind aus </p><p>demselben Grunde da, der euch bestimmt hat, die faulen Dienstleute </p><p>hierzulande durchzuf�ttern, weil n�mlich n�rrische Weise der Ansicht </p><p>gewesen sind, das Staatswohl erfordere die st�ndige Bereitschaft einer </p><p>starken und zuverl�ssigen Schutztruppe besonders altgedienter Soldaten; </p><p>denn zu Rekruten hat man kein Vertrauen. Daher m�ssen sie schon deshalb </p><p>auf einen Krieg bedacht sein, um ge�bte Soldaten zur Hand zu haben, und </p><p>sie m�ssen sich nach Menschen umsehen, die kostenlos abgeschlachtet </p><p>werden k�nnen, damit nicht, wie Sallust so fein sagt, Hand und Herz </p><p>durch Unt�tigkeit zu erschlaffen beginnen. </p><p>Wie verderblich es aber ist, derartige Bestien zu f�ttern, hat nicht </p><p>blo� Frankreich zu seinem eigenen Schaden erfahren; auch das Beispiel </p><p>der R�mer, Karthager, Syrer und vieler anderer V�lker beweist es. Bei </p><p>diesen allen haben die stehenden Heere bald bei dieser und bald bei </p><p>jener Gelegenheit nicht blo� die Regierung gest�rzt, sondern auch das </p><p>flache Land und sogar die festen St�dte zugrunde gerichtet. Aber wie </p><p>unn�tig ist solch ein stehendes Heer! Das kann man schon daraus ersehen, </p><p>da� auch die franz�sischen S�ldner, die doch durch und durch ge�bte </p><p>Soldaten sind, sich nicht r�hmen k�nnen, im Kampfe mit euren Aufgeboten </p><p>sehr oft den Sieg davongetragen zu haben. Ich will jetzt nichts weiter </p><p>sagen; es k�nnte sonst den Anschein erwecken, als wollte ich euch, die </p><p>ihr hier zugegen seid, schmeicheln. Aber man kann gar nicht glauben, da� </p><p>sich eure Handwerker in der Stadt und eure ungeschlachten Bauern auf dem </p><p>Lande vor dem faulen Tro� der Edelleute sehr f�rchten au�er denjenigen, </p><p>denen es infolge ihrer k�rperlichen Schw�che an Kraft und K�hnheit fehlt </p><p>oder deren Energie durch h�usliche Not geschw�cht wird. So wenig ist </p><p>also zu bef�rchten, da� diese Leute etwa verweichlicht werden k�nnten, </p><p>wenn sie f�r einen n�tzlichen Lebensberuf ausgebildet und in </p><p>M�nnerarbeit ge�bt werden. Vielmehr erschlaffen jetzt ihre gesunden und </p><p>kr�ftigen K�rper -- die Edelleute geruhen n�mlich, nur ausgesuchte Leute </p><p>zugrunde zu richten -- durch Nichtstun, oder sie werden durch fast </p><p>weibische Besch�ftigung verweichlicht. Auf keinen Fall liegt es, will </p><p>mir scheinen, -- wie es sich auch sonst mit dieser Sache verhalten mag </p><p>-- im Interesse des Staates, nur f�r den Kriegsfall, den ihr doch nur </p><p>habt, wenn ihr ihn haben wollt, eine unerme�liche Schar von Menschen</p><p>dieser Sorte durchzuf�ttern, die den Frieden so gef�hrden, auf den man </p><p>doch um so viel mehr bedacht sein sollte als auf den Krieg. </p><p>Und doch ist das nicht der einzige Zwang zum Stehlen. Es gibt noch </p><p>einen anderen, der euch, wie ich meine, in h�herem Grade eigent�mlich </p><p>ist.� </p><p>�Welcher ist das?� fragte der Kardinal. </p><p>�Eure Schafe�, sagte ich. �Sie, die gew�hnlich so zahm und gen�gsam </p><p>sind, sollen jetzt so gefr��ig und wild geworden sein, da� sie sogar </p><p>Menschen verschlingen sowie Felder, H�user und St�dte verw�sten und </p><p>entv�lkern. In all den Gegenden eures Reiches n�mlich, wo die feinere </p><p>und deshalb teurere Wolle gewonnen wird, gen�gen dem Adel und den </p><p>Edelleuten und sogar bisweilen �bten, heiligen M�nnern, die j�hrlichen </p><p>Eink�nfte und Ertr�gnisse nicht mehr, die ihre Vorg�nger aus ihren </p><p>G�tern erzielten. Nicht zufrieden damit, da� sie mit ihrem faulen und </p><p>�ppigen Leben der Allgemeinheit nichts n�tzen, sondern eher schaden, </p><p>lassen sie kein Ackerland �brig, z�unen alles als Viehweiden ein, rei�en </p><p>die H�user nieder, zerst�ren die St�dte, lassen nur die Kirchen als </p><p>Schafst�lle stehen und, gerade als ob bei euch die Wildgehege und </p><p>Parkanlagen nicht schon genug Grund und Boden der Nutzbarmachung </p><p>entz�gen, verwandeln diese braven Leute alle bewohnten Pl�tze und alles </p><p>sonst irgendwo angebaute Land in Ein�den. </p><p>Damit also ein einziger Verschwender, uners�ttlich und eine grausige </p><p>Pest seines Vaterlandes, einige tausend Morgen zusammenh�ngenden </p><p>Ackerlandes mit einem einzigen Zaun umgeben kann, vertreibt man P�chter </p><p>von Haus und Hof. Entweder umgarnt man sie durch Lug und Trug oder </p><p>�berw�ltigt sie mit Gewalt; man pl�ndert sie aus oder treibt sie, durch </p><p>Gewaltt�tigkeiten bis zur Ersch�pfung gequ�lt, zum Verkauf ihrer Habe. </p><p>So oder so wandern die Ungl�cklichen aus, M�nner und Weiber, Ehem�nner </p><p>und Ehefrauen, Waisen, Witwen, Eltern mit kleinen Kindern oder mit einer </p><p>Familie, weniger reich an Besitz als an Zahl der Personen, wie ja die </p><p>Landwirtschaft vieler H�nde bedarf. Sie wandern aus, sage ich, aus ihren </p><p>vertrauten und gewohnten Heimst�tten und finden keinen Zufluchtsort. </p><p>Ihren gesamten Hausrat, der ohnehin keinen gro�en Erl�s bringen w�rde, </p><p>auch wenn er auf einen K�ufer warten k�nnte, verkaufen sie um ein </p><p>Spottgeld, wenn sie ihn sich vom Halse schaffen m�ssen. Ist dann der </p><p>geringe Erl�s in kurzer Zeit auf der Wanderschaft verbraucht, was bleibt </p><p>ihnen dann schlie�lich anderes �brig, als zu stehlen und am Galgen zu </p><p>h�ngen -- nach Recht und Gesetz nat�rlich -- oder sich herumzutreiben </p><p>und zu betteln, obgleich sie auch dann als Vagabunden eingesperrt </p><p>werden, weil sie herumlaufen, ohne zu arbeiten? Und doch will sie </p><p>niemand als Arbeiter in Dienst nehmen, so eifrig sie sich auch anbieten. </p><p>Denn mit der Landarbeit, an die sie gew�hnt sind, ist es vorbei, wo </p><p>nicht ges�t wird; gen�gt doch ein einziger Schaf- oder Rinderhirt als </p><p>Aufsicht, um von seinen Herden ein St�ck Land abweiden zu lassen, zu </p><p>dessen Bestellung als Saatfeld viele H�nde notwendig waren. </p><p>So kommt es auch, da� an vielen Orten die Lebensmittel wesentlich teurer </p><p>geworden sind. Ja, auch die Wolle ist so im Preis gestiegen, da� eure </p><p>weniger bemittelten Tuchmacher sie �berhaupt nicht mehr kaufen k�nnen </p><p>und dadurch in der Mehrzahl arbeitslos werden. Nachdem man n�mlich die </p><p>Weidefl�chen so vergr��ert hatte, raffte eine Seuche eine unz�hlige </p><p>Menge Schafe hinweg, gleich als ob Gott die Habgier der Besitzer h�tte </p><p>bestrafen wollen mit der Seuche, die er unter ihre Schafe sandte und die </p><p>-- so w�re es gerechter gewesen -- die Eigent�mer selbst h�tte treffen </p><p>m�ssen. Mag aber auch die Zahl der Schafe noch so sehr zunehmen, der</p><p>Preis der Wolle f�llt nicht, weil der Handel damit, wenn man ihn auch </p><p>nicht Monopol nennen darf, da ja nicht blo� einer verkauft, sicher doch </p><p>ein Oligopol ist. Die Schafe befinden sich n�mlich fast s�mtlich in den </p><p>H�nden einiger weniger, und zwar eben der reichen Leute, die keine </p><p>Notwendigkeit dazu dr�ngt, eher zu verkaufen, als es ihnen beliebt, und </p><p>es beliebt ihnen nicht eher, als bis sie beliebig teuer verkaufen </p><p>k�nnen. Wenn ferner auch die �brigen Viehsorten in gleicher Weise im </p><p>Preise gestiegen sind, so ist daf�r derselbe Grund ma�gebend, und zwar </p><p>hierf�r erst recht, weil sich n�mlich nach Zerst�rung der Bauernh�fe und </p><p>nach Vernichtung der Landwirtschaft niemand mehr mit der Aufzucht von </p><p>Jungvieh abgibt. Jene Reichen treiben n�mlich nur Schafzucht, ziehen </p><p>aber kein Rindvieh mehr auf. Sie kaufen vielmehr anderswo Magervieh </p><p>billig auf, m�sten es auf ihren Weiden und verkaufen es dann f�r viel </p><p>Geld weiter. Und nur deshalb empfindet man, meine ich, den ganzen </p><p>Schaden dieses Verfahrens noch nicht in vollem Umfange, weil jene bis </p><p>jetzt die Preise nur dort hochgetrieben haben, wo sie verkaufen. </p><p>Schaffen sie aber erst einmal eine Zeitlang das Vieh schneller fort, als </p><p>es nachwachsen kann, so nimmt dann schlie�lich auch dort, wo es </p><p>aufgekauft wird, der Bestand allm�hlich ab, und es entsteht dann durch </p><p>starken Mangel notwendigerweise eine Notlage. So hat die ruchlose </p><p>Habgier einiger weniger das, was das ganz besondere Gl�ck dieser eurer </p><p>Insel zu sein schien, gerade euer Verderben werden lassen. Denn diese </p><p>Verteuerung der Lebensmittel ist f�r einen jeden der Anla�, soviel </p><p>Dienerschaft wie m�glich zu entlassen: wohin, so frage ich, wenn nicht </p><p>zur Bettelei oder, wozu man ritterliche Gem�ter leichter �berreden kann, </p><p>zur R�uberei? </p><p>Was soll man aber dazu sagen, da� sich zu dieser elenden Verarmung und </p><p>Not noch l�stige Verschwendungssucht gesellt? Denn sowohl die </p><p>Dienerschaft des Adels wie die Handwerker und fast ebenso die Bauern </p><p>selbst, ja, alle St�nde �berhaupt, treiben viel �berm��igen Aufwand in </p><p>Kleidung und zu gro�en Luxus im Essen. Denke ferner an die Kneipen, </p><p>Bordelle und an die andere Art von Bordellen, ich meine die Weinschenken </p><p>und die Bierh�user, schlie�lich an die so zahlreichen nichtsnutzigen </p><p>Spiele, wie W�rfelspiel, Karten, W�rfelbecher, Ball-, Kugel- und </p><p>Scheibenspiel! Treibt nicht alles dies seine Anbeter geradeswegs zum </p><p>Raube auf die Stra�e, sobald sie ihr Geld vertan haben? </p><p>Bek�mpft diese verderblichen Seuchen! Trefft die Bestimmung, da� </p><p>diejenigen, die die Geh�fte und l�ndlichen Siedlungen zerst�rt haben, </p><p>sie wieder aufbauen oder denen abtreten, die zum Wiederaufbau bereit </p><p>sind und bauen _wollen_! Schr�nkt jene �blen Aufk�ufe der Reichen und </p><p>die Freiheit ihres Handels ein, der einem Monopol gleichkommt! Die Zahl </p><p>derer, die vom M��iggang leben, soll kleiner werden; der Ackerbau soll </p><p>wieder aufleben; die Wollspinnerei soll wieder in Gang kommen, damit es </p><p>eine ehrbare Besch�ftigung gibt, durch die jene Schar von Tagedieben </p><p>einen nutzbringenden Erwerb findet, sie, die die Not bisher zu Dieben </p><p>gemacht hat oder die jetzt Landstreicher oder m��ige Dienstmannen sind </p><p>und ohne Zweifel dereinst Diebe sein werden! Soviel steht fest: wenn ihr </p><p>diesen �belst�nden nicht abhelft, so m�gt ihr euch umsonst eurer </p><p>Gerechtigkeit bei der Bestrafung von Diebst�hlen r�hmen! Eure Justiz </p><p>blendet wohl durch den Schein, aber gerecht oder n�tzlich ist sie nicht. </p><p>Wenn ihr den Menschen eine kl�gliche Erziehung zuteil werden und ihren </p><p>Charakter von zarter Jugend an allm�hlich verderben la�t, um sie </p><p>offenbar erst dann zu bestrafen, wenn sie als Erwachsene die Schandtaten </p><p>begehen, die man von Kindheit an bei ihnen dauernd erwartet hat, was tut </p><p>ihr da anderes, ich bitte euch, als da� ihr sie erst zu Dieben macht und </p><p>dann bestraft?� </p><p>Schon w�hrend ich so sprach, hatte sich jener Rechtsgelehrte zum Reden </p><p>fertig gemacht und sich entschlossen, jene �bliche Methode der </p><p>Schuldisputanten anzuwenden, die sorgf�ltiger wiederholen als antworten; </p><p>in dem Grade macht f�r sie ihr Ged�chtnis einen guten Teil ihres Ruhmes </p><p>aus. �Was du da sagst, klingt in der Tat recht h�bsch�, erwiderte er. </p><p>�Freilich darf man nicht vergessen, da� du als Fremder �ber diese Dinge </p><p>mehr nur etwas hast h�ren als genau erforschen k�nnen, was ich mit </p><p>wenigen Worten beweisen werde. Und zwar will ich zuerst deine </p><p>Ausf�hrungen der Reihe nach durchgehen; sodann will ich zeigen, worin du </p><p>dich infolge von Unkenntnis unserer Verh�ltnisse get�uscht hast; zum </p><p>Schlu� will ich alle deine Thesen entkr�ften und widerlegen. </p><p>Um also mit dem ersten Teile meines Versprechens zu beginnen, so hast </p><p>du, wie mir scheint,�...� </p><p>�Still!� rief da der Kardinal. �Da du n�mlich so anf�ngst, wirst du, wie </p><p>mir scheint, nicht mit einigen wenigen Worten nur antworten wollen. </p><p>Deshalb soll dir f�r den Augenblick die M�he zu antworten erspart </p><p>bleiben. Wir wollen dir jedoch diese Verpflichtung uneingeschr�nkt f�r </p><p>eure n�chste Zusammenkunft aufheben, die ich schon morgen stattfinden </p><p>lassen m�chte, falls ihr, du und Raphael, nichts anderes vorhaben </p><p>solltet. Inzwischen aber h�tte ich von dir, mein Raphael, sehr gern </p><p>geh�rt, warum du der Ansicht bist, Diebstahl sei nicht mit dem Tode zu </p><p>bestrafen, und welche andere Strafe du selbst vorschl�gst, die mehr dem </p><p>�ffentlichen Interesse entspricht; denn daf�r, den Diebstahl einfach zu </p><p>dulden, bist du doch gewi� auch nicht. Wenn man aber jetzt sogar trotz </p><p>der Lebensgefahr das Stehlen nicht l��t, welche Gewalt oder welche </p><p>Bef�rchtung k�nnte dann die Verbrecher abschrecken, nachdem ihnen erst </p><p>einmal ihr Leben gesichert ist? W�rden sie es nicht so auffassen, als ob </p><p>die Milderung der Strafe sie gewisserma�en durch eine Pr�mie zum </p><p>Verbrechen geradezu ermuntere?� </p><p>�Ich bin durchaus der Ansicht, g�tiger Vater�, erwiderte ich, �da� es </p><p>ganz ungerecht ist, einem Menschen das Leben zu nehmen, weil er Geld </p><p>gestohlen hat; denn auch s�mtliche Gl�cksg�ter k�nnen meiner Meinung </p><p>nach ein Menschenleben nicht aufwiegen. Wollte man nun aber sagen, diese </p><p>Strafe solle die Rechtsverletzung oder die �bertretung der Gesetze, </p><p>nicht das gestohlene Geld aufwiegen, m��te man dann nicht erst recht </p><p>jenes strengste Recht als gr��tes Unrecht bezeichnen? Denn weder darf </p><p>man Gesetze nach Art eines Manlius billigen, so da� bei einer </p><p>Gehorsamsverweigerung auch in den leichtesten F�llen sofort das Schwert </p><p>zum Todesstreiche gez�ckt wird, noch so stoische Grunds�tze, da� man die </p><p>Vergehen alle als gleich beurteilt und der Ansicht ist, es sei kein </p><p>Unterschied, ob einer einen Menschen t�tet oder ihm nur Geld raubt, </p><p>Vergehen, zwischen denen �berhaupt keine �hnlichkeit oder Verwandtschaft </p><p>besteht, wenn Recht und Billigkeit �berhaupt noch etwas gelten. Gott hat </p><p>es verboten, jemanden zu t�ten, und wir t�ten so leichten Herzens um </p><p>eines gestohlenen S�mmchens willen? Sollte es aber jemand so auffassen </p><p>wollen, als ob jenes g�ttliche Gebot die T�tung eines Menschen nur </p><p>insoweit verbiete, als sie nicht ein menschliches Gesetz gebietet, was </p><p>steht dann dem im Wege, da� die Menschen auf dieselbe Weise unter sich </p><p>festsetzen, inwieweit Unzucht zu dulden sei und Ehebruch und Meineid? </p><p>Gott hat einem jeden die Verf�gung nicht nur �ber ein fremdes, sondern </p><p>sogar �ber das eigene Leben genommen; wenn aber menschliches </p><p>�bereinkommen, sich unter gewissen Voraussetzungen gegenseitig t�ten zu </p><p>d�rfen, so viel gelten soll, da� es seine dienstbaren Geister von den </p><p>Bindungen jenes Gebotes befreit und diese dann ohne jede g�ttliche </p><p>Strafe Menschen ums Leben bringen d�rfen, die Menschensatzung zu t�ten </p><p>befiehlt, bleibt dann nicht jenes Gottesgebot nur insoweit in Geltung,</p><p>als Menschenrecht es erlaubt? Und so wird es in der Tat dahin kommen, </p><p>da� auf dieselbe Weise die Menschen festsetzen, inwieweit Gottes Gebote </p><p>beachtet werden sollen! Und schlie�lich hat sogar das mosaische Gesetz, </p><p>obwohl erbarmungslos und hart, da es f�r Sklavenseelen, und zwar f�r </p><p>verstockte, erlassen war, den Diebstahl trotzdem nur mit Geld und nicht </p><p>mit dem Tode bestraft. Wir wollen doch nicht glauben, da� Gott mit dem </p><p>neuen Gesetz der Gnade, durch das er als Vater seinen Kindern gebietet, </p><p>uns gr��ere Freiheit gew�hrt hat, gegeneinander zu w�ten! </p><p>Das sind die Gr�nde, die ich gegen die Todesstrafe vorzubringen habe. In </p><p>welchem Grade aber widersinnig und sogar verderblich f�r den Staat eine </p><p>gleichm��ige Bestrafung des Diebes und des M�rders ist, das wei�, meine </p><p>ich, jeder. Wenn n�mlich der R�uber sieht, da� einem, der wegen blo�en </p><p>Diebstahls verurteilt ist, keine geringere Strafe droht, als wenn der </p><p>Betreffende au�erdem noch des Mordes �berf�hrt wird, so veranla�t ihn </p><p>schon diese eine �berlegung zur Ermordung desjenigen, den er andernfalls </p><p>nur beraubt h�tte. Denn abgesehen davon, da� f�r einen, der ertappt </p><p>wird, die Gefahr nicht gr��er ist, gew�hrt ihm der Mord sogar noch </p><p>gr��ere Sicherheit und mehr Aussicht, da� die Tat unentdeckt bleibt, da </p><p>ja der, der sie anzeigen k�nnte, beseitigt ist. W�hrend wir uns also </p><p>bem�hen, den Dieben durch allzu gro�e Strenge Schrecken einzujagen, </p><p>spornen wir sie dazu an, gute Menschen umzubringen. </p><p>Was ferner die �bliche Frage nach einer besseren Art der Bestrafung </p><p>anlangt, so ist diese viel leichter zu finden als eine noch weniger </p><p>gute. Warum sollten wir denn eigentlich an der N�tzlichkeit jener </p><p>Methode der Bestrafung von Verbrechen zweifeln, die, wie wir wissen, in </p><p>alten Zeiten so lange den R�mern zugesagt hat, die doch so gro�e </p><p>Erfahrung in der Staatsverwaltung besa�en? Diese pflegten n�mlich </p><p>�berf�hrte Schwerverbrecher zur Arbeit in den Steinbr�chen und </p><p>Bergwerken zu verurteilen, wo sie dauernd Fesseln tragen mu�ten. Jedoch </p><p>habe ich in dieser Beziehung auf meinen Reisen bei keinem Volke eine </p><p>bessere Einrichtung gefunden als in Persien bei den sogenannten </p><p>Polyleriten, einem ansehnlichen Volke mit einer recht verst�ndigen </p><p>Verfassung, das dem Perserk�nig nur einen j�hrlichen Tribut zahlt, im </p><p>�brigen aber unabh�ngig ist und nach eigenen Gesetzen lebt. Sie wohnen </p><p>weitab vom Meere, sind fast ganz von Bergen eingeschlossen, begn�gen </p><p>sich in jeder Beziehung durchaus mit den Ertr�gnissen ihres Landes und </p><p>pflegen mit anderen V�lkern wenig Verkehr. Infolgedessen sind sie auch, </p><p>einem alten Herkommen ihres Volkes entsprechend, nicht auf Erweiterung </p><p>ihres Gebietes bedacht. Innerhalb dieses selbst aber bieten ihnen ihre </p><p>Berge sowie das Geld, das sie dem Eroberer zahlen, m�helos Schutz vor </p><p>jeder Gewalttat. V�llig frei vom Kriegsdienst, f�hren sie ein nicht </p><p>ebenso gl�nzendes wie bequemes Leben in mehr Gl�ck als Vornehmheit und </p><p>Ber�hmtheit, ja nicht einmal dem Namen nach, meine ich, hinreichend </p><p>bekannt au�er in der Nachbarschaft. Wer nun bei den Polyleriten wegen </p><p>Diebstahls verurteilt wird, gibt das Gestohlene dem Eigent�mer zur�ck, </p><p>nicht, wie es anderswo Brauch ist, dem Landesherrn, weil dieser nach </p><p>ihrer Meinung auf das gestohlene Gut ebenso wenig Anspruch hat wie der </p><p>Dieb selbst. Ist es aber abhanden gekommen, so ersetzt und bezahlt man </p><p>seinen Wert aus dem Besitz der Diebe, den Rest behalten ihre Frauen und </p><p>Kinder unverk�rzt, und die Diebe selbst verurteilt man zu Zwangsarbeit. </p><p>Nur wenn schwerer Diebstahl vorliegt, sperrt man sie ins Arbeitshaus, wo </p><p>sie Fu�fesseln tragen m�ssen; sonst behalten sie ihre Freiheit und </p><p>verrichten ungefesselt �ffentliche Arbeiten. Zeigen sie sich </p><p>widerspenstig und zu tr�ge, so legt man sie zur Strafe nicht in Fesseln, </p><p>sondern treibt sie durch Pr�gel zur Arbeit an; Flei�ige dagegen bleiben </p><p>von Gewaltt�tigkeiten verschont; nur des Nachts schlie�t man sie in </p><p>Schlafr�ume ein, nachdem man sie durch Namensaufruf kontrolliert hat.</p><p>Die dauernde Arbeit ist die einzige Unannehmlichkeit in ihrem Leben. </p><p>Ihre Verpflegung ist n�mlich nicht k�rglich. F�r diejenigen, die </p><p>�ffentliche Arbeiten verrichten, wird sie aus �ffentlichen Mitteln </p><p>bestritten, und zwar in den einzelnen Gegenden auf verschiedene Weise. </p><p>Hier und da n�mlich deckt man den Aufwand f�r sie aus Almosen; wenn </p><p>diese Methode auch unsicher ist, so bringt doch bei der mildt�tigen </p><p>Gesinnung jenes Volkes keine andere einen reicheren Ertrag. Anderswo </p><p>wieder sind gewisse �ffentliche Eink�nfte f�r diesen Zweck bestimmt. In </p><p>manchen Gegenden findet daf�r auch eine feste Kopfsteuer Verwendung. Ja, </p><p>an einigen Orten verrichten die Str�flinge keine Arbeit f�r die </p><p>�ffentlichkeit, sondern, wenn ein Privatmann Lohnarbeiter braucht, so </p><p>mietet er die Arbeitskraft eines beliebigen von ihnen auf dem Markte f�r </p><p>den betreffenden Tag und zahlt daf�r einen festgesetzten Lohn, nur etwas </p><p>weniger, als er f�r freie Lohnarbeit w�rde zahlen m�ssen. Au�erdem steht </p><p>ihm das Recht zu, faule Sklaven zu peitschen. Auf diese Weise haben sie </p><p>niemals Mangel an Arbeit, und au�er seinem Lebensunterhalt verdient </p><p>jeder t�glich noch etwas, was er an die Staatskasse abf�hrt. Sie allein </p><p>sind alle in eine bestimmte Farbe gekleidet und tragen das Haar nicht </p><p>vollst�ndig geschoren, sondern nur ein St�ck �ber den Ohren </p><p>verschnitten, und das eine Ohr ist etwas gestutzt. Speise, Trank und </p><p>Kleidung von seiner Farbe darf sich jeder von seinen Freunden geben </p><p>lassen; wer dagegen ein Geldgeschenk gibt oder annimmt, wird mit dem </p><p>Tode bestraft; und nicht weniger gef�hrlich ist es auch f�r einen </p><p>Freien, aus irgendeinem Grunde von einem Str�fling Geld anzunehmen, und </p><p>ebenso f�r die Sklaven -- so nennt man n�mlich die Str�flinge�--, Waffen </p><p>anzur�hren. Jede Landschaft macht ihre Sklaven durch ein eigenes, </p><p>unterscheidendes Zeichen kenntlich, das abzulegen bei Todesstrafe </p><p>verboten ist. Dieselbe Strafe trifft auch den, der sich au�erhalb seines </p><p>Bezirks sehen l��t oder mit einem Sklaven eines anderen Bezirks ein Wort </p><p>spricht. Die Planung einer Flucht ist ebenso gef�hrlich wie ihre </p><p>Ausf�hrung; schon von einem solchen Plane gewu�t zu haben, bedeutet f�r </p><p>den Sklaven den Tod und f�r den Freien Knechtschaft. Dagegen sind auf </p><p>Anzeigen Preise ausgesetzt, und zwar erh�lt ein Freier Geld, ein Sklave </p><p>dagegen die Freiheit; beiden aber gew�hrt man Verzeihung und </p><p>Straflosigkeit, auch wenn sie von der Sache gewu�t haben. Dadurch will </p><p>man verh�ten, da� es mehr Sicherheit bietet, auf einem schlimmen Plane </p><p>zu beharren als ihn zu bereuen. </p><p>So also ist diese Angelegenheit gesetzlich geregelt, wie ich es </p><p>beschrieben habe. Wie menschlich und zweckm��ig dieses Verfahren ist, </p><p>kann man leicht einsehen. �bt es doch nur insoweit Strenge aus, als die </p><p>Verbrechen beseitigt werden; dabei kostet es kein Menschenleben, und die </p><p>�belt�ter werden so behandelt, da� sie gar nicht anders k�nnen, als gut </p><p>zu sein und den Schaden, den sie vorher angerichtet haben, durch ihr </p><p>weiteres Leben wieder gutzumachen. </p><p>Da� ferner Str�flinge in ihre alte Lebensweise verfallen k�nnten, ist </p><p>durchaus nicht zu bef�rchten. Infolgedessen halten sich auch Fremde, die </p><p>irgendwohin reisen m�ssen, unter keiner anderen F�hrung f�r sicherer als </p><p>unter der jener Sklaven, die dann von einer Gegend zur anderen </p><p>unmittelbar wechseln. Denn sie besitzen nichts, was sie zu einem </p><p>Raub�berfall reizen k�nnte: in der Hand haben sie keine Waffe, Geld </p><p>w�rde ihre verbrecherische Tat nur verraten, und der Ertappte m��te mit </p><p>Bestrafung und v�lliger Aussichtslosigkeit, irgendwohin fliehen zu </p><p>k�nnen, rechnen. Wie sollte es n�mlich jemand auch fertig bringen, </p><p>v�llig unbemerkt zu fliehen, wenn sich seine Kleidung in jedem St�ck von </p><p>der seiner Landsleute unterscheidet? Er m��te sich denn gerade nackend </p><p>entfernen. Ja, auch in dem Falle w�rde den Ausrei�er das Ohr verraten. </p><p>Aber k�nnten die Str�flinge nicht vielleicht an eine Verschw�rung gegen</p><p>den Staat denken? W�re das nicht doch eine Gefahr? Als ob irgendeine </p><p>Gruppe solch eine Hoffnung hegen d�rfte, ehe nicht die Sklaven </p><p>zahlreicher Landschaften unruhig geworden und aufgewiegelt sind, denen </p><p>es nicht einmal erlaubt ist zusammenzukommen, miteinander zu sprechen </p><p>oder sich gegenseitig zu gr��en, die also noch viel weniger eine </p><p>Verschw�rung anzetteln k�nnten! Sollte man ferner annehmen d�rfen, sie </p><p>w�rden diesen Plan inzwischen unbesorgt ihren Anh�ngern anvertrauen, </p><p>w�hrend sie doch wissen, da� Verschweigen gef�hrlich, Verrat aber h�chst </p><p>vorteilhaft ist? Und dabei hat niemand so g�nzlich die Hoffnung </p><p>aufgegeben, doch irgendwann einmal die Freiheit wieder zu erlangen, wenn </p><p>er sich gehorsam zeigt und eine Besserung in der Zukunft zuversichtlich </p><p>erwarten l��t. Wird doch in jedem Jahre ein paar Sklaven zum Lohn f�r </p><p>geduldiges Ausharren die Freiheit wieder geschenkt.� </p><p>So sprach ich. Als ich dann noch hinzuf�gte, es liege meiner Meinung </p><p>nach gar kein Grund vor, dieses Verfahren nicht auch in England </p><p>anzuwenden, und zwar mit viel gr��erem Erfolg als jenen Rechtsbrauch, </p><p>den der Jurist so sehr gelobt hatte, da erwiderte mir dieser sofort: </p><p>�Niemals lie�e sich dieser Brauch in England einf�hren, ohne da� der </p><p>Staat dadurch in die gr��te Gefahr geriete!� Und bei diesen Worten </p><p>sch�ttelte er den Kopf, verzog den Mund und schwieg dann, und alle </p><p>Anwesenden stimmten ihm zu. Da meinte der Kardinal: �Man kann nicht so </p><p>leicht voraussagen, ob die Sache g�nstig oder ung�nstig ausgeht, solange </p><p>man sie �berhaupt noch nicht erprobt hat. Aber nach Verk�ndigung eines </p><p>Todesurteils k�nnte ja der Landesherr einen Aufschub der Vollstreckung </p><p>anordnen und unter Einschr�nkung der Privilegien der Asylst�tten dieses </p><p>neue Verfahren erproben. Sollte es sich durch den Erfolg als zweckm��ig </p><p>bew�hren, so w�re es wohl richtig, es zur dauernden Einrichtung zu </p><p>machen. Andernfalls k�nnte man ja die vorher Verurteilten auch dann noch </p><p>hinrichten, und das w�re von nicht geringem Vorteil f�r den Staat und </p><p>nicht ungerechter, als wenn es gleich gesch�he, und auch in der Zeit </p><p>des Aufschubs k�nnte keine Gefahr daraus erwachsen. Ja, wie mir sicher </p><p>scheint, w�rde dieselbe Behandlung auch den Landstreichern gegen�ber </p><p>sehr angebracht sein; denn gegen sie haben wir zwar bis jetzt eine Menge </p><p>Gesetze erlassen, aber trotzdem noch nichts erreicht.� </p><p>Sobald der Kardinal das gesagt hatte -- dasselbe, wor�ber sich alle </p><p>ver�chtlich ge�u�ert hatten, als sie es von mir h�rten�--, wetteiferte </p><p>jeder, ihm das h�chste Lob zu spenden, besonders jedoch seinem Vorschlag </p><p>in betreff der Landstreicher, weil er den von sich aus hinzugef�gt </p><p>hatte. </p><p>Vielleicht w�re es besser, das, was jetzt folgte, gar nicht zu erw�hnen </p><p>-- es war n�mlich l�cherlich�--, aber ich will es doch erz�hlen; denn es </p><p>war nicht �bel und geh�rte in gewissem Sinne zu unserer Sache. Es stand </p><p>zuf�llig ein Schmarotzer dabei, der offenbar den Narren spielen wollte, </p><p>sich aber so schlecht verstellte, da� er mehr einem wirklichen Narren </p><p>glich, indem er mit so faden �u�erungen nach Gel�chter haschte, da� man </p><p>h�ufiger �ber seine Person als �ber seine Worte lachte. Zuweilen jedoch </p><p>�u�erte der Mensch auch etwas, was nicht ganz so albern war, so da� er </p><p>das Sprichwort best�tigte: �Wer viel w�rfelt, hat auch einmal Gl�ck.� Da </p><p>meinte einer von den Tischgenossen, ich h�tte mit meiner Rede gut f�r </p><p>die Diebe gesorgt und der Kardinal auch noch f�r die Landstreicher; nun </p><p>bleibe nur noch �brig, von Staats wegen auch noch die zu versorgen, die </p><p>durch Krankheit oder Alter in Not geraten und arbeitsunf�hig geworden </p><p>seien. �La� mich das machen!� rief da der Spa�vogel. �Ich will auch das </p><p>in Ordnung bringen! Denn es ist mein sehnlicher Wunsch, mich vom Anblick </p><p>dieser Sorte Menschen irgendwie zu befreien. Mehr als einmal sind sie </p><p>mir schwer zur Last gefallen, wenn sie mich mit ihrem Klagegeheul um</p><p>Geld anbettelten. Niemals jedoch konnten sie das sch�n genug anstimmen, </p><p>um auch nur einen Pfennig von mir zu erpressen. Es ist bei mir n�mlich </p><p>immer das eine von beiden der Fall: entweder habe ich keine Lust, etwas </p><p>zu geben, oder ich habe nicht die M�glichkeit dazu, weil ich nichts zu </p><p>geben habe. Infolgedessen werden die Bettler jetzt allm�hlich </p><p>vern�nftig. Um sich n�mlich nicht unn�tig anzustrengen, reden sie mich </p><p>gar nicht mehr an, wenn sie mich vor�bergehen sehen. So wenig erhoffen </p><p>sie von mir noch etwas, in der Tat nicht mehr, als wenn ich ein Priester </p><p>w�re. Aber jetzt befehle ich, ein Gesetz zu erlassen, dem zufolge alle </p><p>jene Bettler ohne Ausnahme auf die Benediktinerkl�ster verteilt und zu </p><p>sogenannten Laienbr�dern gemacht werden; die Weiber aber, ordne ich an, </p><p>sollen Nonnen werden.� </p><p>Da l�chelte der Kardinal und stimmte im Scherz zu, die anderen dann auch </p><p>im Ernst. Indessen heiterte dieser Witz �ber die Priester und M�nche </p><p>einen Theologen, einen Klosterbruder, so auf, da� er, sonst ein ernster, </p><p>ja beinahe finsterer Mann, jetzt gleichfalls anfing, Spa� zu machen. </p><p>�Aber auch so�, rief er, �wirst du die Bettler nicht loswerden, wenn du </p><p>nicht auch f�r uns Klosterbr�der sorgst!� </p><p>�Aber das ist doch schon geschehen�, erwiderte der Parasit. �Der </p><p>Kardinal hat ja vortrefflich f�r euch gesorgt, indem er f�r die </p><p>Tagediebe Zwangsarbeit festsetzte; denn ihr seid doch die gr��ten </p><p>Tagediebe.� </p><p>Da blickten alle auf den Kardinal. Als sie aber sahen, da� er auch diese </p><p>Bemerkung nicht zur�ckwies, fingen sie alle an, sie mit gro�em Vergn�gen </p><p>aufzunehmen; nur der Klosterbruder machte eine Ausnahme. Der n�mlich, </p><p>mit solchem Essig �bergossen, geriet derma�en in Zorn und Hitze -- </p><p>wor�ber ich mich auch gar nicht wundere�--, da� er sich nicht mehr </p><p>beherrschen konnte und zu schimpfen anfing. Er nannte den Menschen einen </p><p>Taugenichts, einen Verleumder, einen Ohrenbl�ser und ein Kind der </p><p>Verdammnis und f�hrte zwischendurch schreckliche Drohungen aus der </p><p>Heiligen Schrift an. Jetzt aber begann der Witzbold ernsthaft zu spa�en, </p><p>und da war er ganz in seinem Element. �Z�rne nicht, lieber Bruder!� </p><p>sagte er. �Es steht geschrieben: 'Durch standhaftes Ausharren sollt ihr </p><p>euch das Leben gewinnen.'� Darauf erwiderte der Klosterbruder -- ich </p><p>will n�mlich seine eigenen Worte wiedergeben�--: �Ich z�rne nicht, du </p><p>Galgenstrick, oder ich s�ndige wenigstens nicht damit. Denn der Psalmist </p><p>sagt: 'Z�rnt und s�ndigt nicht!'� Darauf ermahnte der Kardinal den </p><p>Klosterbruder in sanftem Tone, sich zu m��igen. Doch der antwortete: </p><p>�Herr, ich spreche nur in redlichem Eifer, wie ich es tun mu�. Denn auch </p><p>heilige M�nner haben einen redlichen Eifer bewiesen, weswegen es hei�t: </p><p>'Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt'. Und in den Kirchen singt </p><p>man: </p><p> 'Die Sp�tter Elisas,</p><p> W�hrend er hinaufsteigt zum Hause Gottes,</p><p> Bekommen den Eifer des Kahlkopfs zu sp�ren',</p><p>wie ihn vielleicht auch dieser Sp�tter da, dieser Possenrei�er, dieser </p><p>Bruder Liederlich noch zu sp�ren bekommen wird.� </p><p>�Du handelst vielleicht in ehrlicher Erregung�, sagte der Kardinal, </p><p>�aber mir will scheinen, es w�rde m�glicherweise fr�mmer, bestimmt aber </p><p>kl�ger von dir sein, wenn du nicht mit einem t�richten und l�cherlichen </p><p>Menschen einen l�cherlichen Streit beginnen wolltest.� </p><p>�Nein, Herr, das w�rde nicht kl�ger von mir sein�, erwiderte er. �Sagt</p><p>doch selbst der weise Salomo: 'Antworte dem Narren gem�� seiner </p><p>Narrheit!', wie ich es jetzt tue und ihm die Grube zeige, in die er </p><p>fallen wird, wenn er nicht recht auf der Hut ist. Wenn n�mlich die </p><p>vielen Sp�tter Elisas, der doch nur _ein_ Kahlkopf war, den Eifer des </p><p>Kahlkopfes zu sp�ren bekommen haben, um wieviel mehr wird ein einziger </p><p>Sp�tter den Eifer der vielen Klosterbr�der zu sp�ren bekommen, unter </p><p>denen sich doch viele Kahlk�pfe befinden! Und au�erdem haben wir ja noch </p><p>eine p�pstliche Bulle, auf Grund deren alle, die sich �ber uns lustig </p><p>machen, der Kirchenbann trifft.� </p><p>Sobald der Kardinal sah, da� der Streit kein Ende nehmen wollte, gab er </p><p>dem Schmarotzer einen Wink, sich zu entfernen, und brachte die Rede auf </p><p>ein anderes Thema, das auch Anklang fand. Bald darauf stand er von der </p><p>Tafel auf, entlie� uns und widmete sich seinen Lehnsleuten, deren </p><p>Anliegen er sich anh�rte. </p><p>�Sieh da, mein lieber Morus, wie lang ist doch die Geschichte geworden, </p><p>mit der ich dich bel�stigt habe! Ich h�tte mich entschieden gesch�mt, so </p><p>ausf�hrlich zu werden, wenn du es nicht dringend zu wissen verlangt </p><p>h�ttest und wenn es mir nicht den Eindruck gemacht h�tte, als wolltest </p><p>du auch nicht _ein_ Wort von jenem Gespr�ch ausgelassen wissen; mit </p><p>solcher Aufmerksamkeit h�rtest du mir zu. Ich mu�te dies jedoch alles </p><p>erz�hlen -- freilich h�tte es wesentlich k�rzer geschehen k�nnen�--, um </p><p>die Urteilsf�higkeit dieser Leute ins rechte Licht zu r�cken: wovon sie </p><p>n�mlich nichts wissen wollten, als sie es aus _meinem_ Munde h�rten, </p><p>eben das billigten sie auf der Stelle, als es der Kardinal billigte, und </p><p>zwar gingen sie in ihrer Lobhudelei so weit, da� sie sich sogar die </p><p>Einf�lle seines Schmarotzers, die sein Herr im Scherz nicht zur�ckwies, </p><p>in schmeichlerischer Weise gefallen lie�en und sie beinahe f�r Ernst </p><p>nahmen. Daraus kannst du ermessen, wie hoch die H�flinge mich mit meinen </p><p>Ratschl�gen einsch�tzen w�rden.� </p><p>�In der Tat, mein lieber Raphael�, erwiderte ich, �deine Erz�hlung war </p><p>ein gro�er Genu� f�r mich; so klug und treffend zugleich hast du alles </p><p>gesagt. Au�erdem war es mir w�hrenddem so, als bef�nde ich mich wieder </p><p>in meiner Heimat, und nicht blo� dies, sondern als erlebte ich </p><p>gewisserma�en noch einmal meine Kindheit, bei der angenehmen Erinnerung </p><p>an jenen Kardinal, an dessen Hofe ich als Knabe erzogen worden bin. Lieb </p><p>und wert warst du mir ja auch sonst schon, mein Raphael, aber um wieviel </p><p>teurer du mir durch die so hohe Ehrung des Andenkens an jenen Mann </p><p>geworden bist, kannst du dir kaum vorstellen. Im �brigen kann ich bis </p><p>jetzt meine Ansicht in keinerlei Weise �ndern; ich bin vielmehr </p><p>entschieden der Meinung, wenn du dich entschlie�en k�nntest, deine </p><p>Abneigung gegen die F�rstenh�fe aufzugeben, so k�nntest du mit deinen </p><p>Ratschl�gen der �ffentlichkeit den gr��ten Nutzen stiften. Deshalb ist </p><p>dies deine h�chste Pflicht, die Pflicht eines braven Mannes. Und wenn </p><p>vollends dein Plato der Ansicht ist, die Staaten w�rden erst dann </p><p>gl�cklich sein, wenn entweder die Philosophen K�nige seien oder die </p><p>K�nige sich mit Philosophie befa�ten, wie fern wird da das Gl�ck noch </p><p>sein, wenn es die Philosophen sogar f�r unter ihrer W�rde halten, den </p><p>K�nigen ihren guten Rat zuteil werden zu lassen.� </p><p>�Sie sind nicht so ungef�llig�, antwortete er, �da� sie das nicht gern </p><p>tun w�rden -- sie haben es ja auch schon durch die Ver�ffentlichung </p><p>zahlreicher B�cher getan�--, wenn nur die Machthaber bereit w�ren, die </p><p>guten Ratschl�ge auch zu befolgen. Aber ohne Zweifel hat Plato richtig </p><p>vorausgesehen, da� die K�nige nur dann die Ratschl�ge philosophierender </p><p>M�nner guthei�en werden, wenn sie sich selbst mit Philosophie </p><p>besch�ftigen. Sind sie doch von Kindheit an mit verkehrten Meinungen</p><p>getr�nkt und von ihnen angesteckt, was Plato in eigener Person am Hofe </p><p>des Dionysius erfahren mu�te. Oder meinst du nicht, ich w�rde auf der </p><p>Stelle fortgejagt oder verspottet werden, wenn ich am Hofe irgendeines </p><p>K�nigs gesunde Ma�nahmen vorschl�ge und verderbliche Saaten schlechter </p><p>Ratgeber auszurei�en versuchte? </p><p>Wohlan, stelle dir vor, ich lebte am Hofe des K�nigs von Frankreich und </p><p>s��e mit in seinem Rate, w�hrend man in geheimster Zur�ckgezogenheit </p><p>unter dem Vorsitze des K�nigs selbst in einem Kreise der kl�gsten </p><p>M�nner mit gro�em Eifer dar�ber verhandelt, mit welchen R�nken und </p><p>Machenschaften der K�nig es fertig bringen kann, Mailand zu behaupten, </p><p>jenes immer aufs neue abfallende Neapel wiederzugewinnen, ferner Venedig </p><p>zu vernichten und sich ganz Italien zu unterwerfen, sodann Flandern, </p><p>Brabant und schlie�lich ganz Burgund seinem Reiche einzuverleiben und </p><p>au�erdem noch andere V�lker, in deren Land der K�nig schon l�ngst im </p><p>Geiste eingefallen ist. Hier r�t der eine, mit den Venetianern ein </p><p>B�ndnis zu schlie�en, aber nur f�r so lange, als es den Franzosen Nutzen </p><p>bringt; mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen, ja auch einen Teil </p><p>der Beute ihnen anzuvertrauen und dann wieder zur�ckzuverlangen, wenn </p><p>alles nach Wunsch gegangen ist; ein anderer wieder schl�gt vor, deutsche </p><p>Landsknechte anzuwerben; ein dritter, Schweizer mit Geld kirre zu </p><p>machen; ein vierter, sich die Gunst der kaiserlichen Majest�t durch Gold </p><p>wie durch ein Weihgeschenk zu erkaufen. Ein anderer wieder r�t dem </p><p>F�rsten, sich mit dem K�nig von Aragonien g�tlich zu einigen und ihm </p><p>gleichsam als Unterpfand des Friedens das K�nigreich Navarra abzutreten, </p><p>das ihm aber gar nicht geh�rt. Unterdessen will ein anderer den Prinzen </p><p>von Kastilien durch eine Aussicht auf eine Verschw�gerung ins Garn </p><p>locken und einige Granden seines Hofes durch eine bestimmte Barzahlung </p><p>auf die Seite Frankreichs ziehen. Nun aber st��t man auf die allergr��te </p><p>Schwierigkeit, was man n�mlich bei alledem in betreff Englands </p><p>beschlie�en soll: immerhin m�sse man mit ihm doch wenigstens </p><p>Friedensverhandlungen ankn�pfen und das immer unsicher bleibende B�ndnis </p><p>durch recht starke Bande befestigen; die Engl�nder solle man zwar </p><p>Freunde nennen, ihnen aber wie Feinden mi�trauen und deshalb die </p><p>Schotten f�r jeden Fall schlagfertig, gleichsam auf Posten, in </p><p>Bereitschaft halten und sie sofort auf die Engl�nder loslassen, sobald </p><p>sich diese irgendwie r�hrten. Au�erdem m�sse man einen hohen, in der </p><p>Verbannung lebenden Adligen unterst�tzen, und zwar im geheimen -- eine </p><p>offene Protektion lassen n�mlich die Vertr�ge nicht zu�--, der den </p><p>englischen Thron f�r sich beanspruche. Das solle f�r den K�nig von </p><p>Frankreich eine Handhabe sein, den K�nig von England im Zaume zu halten, </p><p>dem er nicht trauen d�rfe. </p><p>Und nun denke dir, hier, bei einem solchen Drange der Gesch�fte, wenn so </p><p>viele ausgezeichnete M�nner um die Wette Ratschl�ge f�r den Krieg </p><p>erteilen, st�nde ich armseliges Menschenkind auf und hie�e pl�tzlich den </p><p>Kurs �ndern, schl�ge vor, Italien aufzugeben, und behauptete, man m�sse </p><p>im Lande bleiben; das eine K�nigreich Frankreich sei schon fast zu gro�, </p><p>als da� es ein einziger gut verwalten k�nne; der K�nig solle doch nicht </p><p>glauben, er d�rfe noch an die Einverleibung anderer Reiche denken; und </p><p>ich riete ihnen dann weiter, dem Beispiele der Achorier zu folgen, eines </p><p>Volkes, das der Insel Utopia im S�dosten gegen�berliegt. In alten Zeiten </p><p>hatten sie einmal einen Krieg gef�hrt, um ihrem K�nig den Besitz eines </p><p>zweiten Reiches zu sichern, das er auf Grund einer alten Verwandtschaft </p><p>als sein Erbe beanspruchte. Als sie endlich ihr Ziel erreicht hatten, </p><p>mu�ten sie jedoch einsehen, da� die Behauptung des Landes keineswegs </p><p>leichter war als seine Eroberung, da� vielmehr ohne Unterla� </p><p>Auflehnungen im Inneren oder �berf�lle auf die Unterworfenen von au�en </p><p>daraus entstanden, da� sie so dauernd entweder f�r oder gegen jene</p><p>k�mpfen mu�ten, da� sich niemals die M�glichkeit bot, das Heer zu </p><p>entlassen, da� sie selber inzwischen ausgebeutet wurden, da� ihr Geld </p><p>ins Ausland ging, da� sie ihr Blut f�r ein wenig Ruhm eines Fremden </p><p>vergossen, da� der Friede im Inneren durchaus nicht gesicherter war, da� </p><p>der Krieg die Moral verdarb, da� die Raubsucht den Menschen gleichsam in </p><p>Fleisch und Blut �berging, da� die Rauflust infolge der Metzeleien </p><p>zunahm und da� man die Gesetze nicht mehr achtete. Und das alles, weil </p><p>der K�nig sein Interesse, das durch die Sorge f�r zwei Reiche </p><p>zersplittert wurde, jedem einzelnen nicht nachdr�cklich genug zuwenden </p><p>konnte. Da nun die Achorier sahen, diese so schlimmen Zust�nde w�rden </p><p>auf andere Weise kein Ende nehmen, fa�ten sie endlich einen Entschlu� </p><p>und lie�en ihrem F�rsten in �beraus h�flicher Form die Wahl, welches </p><p>Reich von beiden er behalten wolle; beide k�nne er n�mlich nicht l�nger </p><p>behalten; sie seien ein zu gro�es Volk, um von einem 'halbierten' K�nig </p><p>regiert zu werden, wie sich ja auch niemand gern mit einem anderen </p><p>seinen Maultiertreiber w�rde teilen wollen. So sah sich denn jener brave </p><p>F�rst gezwungen, sein neues Reich einem seiner Freunde zu �berlassen -- </p><p>der �brigens bald darauf gleichfalls verjagt wurde -- und sich mit dem </p><p>alten zu begn�gen. Ferner w�rde ich darauf hinweisen, da� alle diese </p><p>kriegerischen Versuche, die um des K�nigs willen so viele V�lker in </p><p>Unruhe versetzen w�rden, durch irgendein Mi�geschick schlie�lich doch </p><p>ohne Erfolg enden k�nnten, nachdem seine Geldmittel ersch�pft und sein </p><p>Volk ruiniert seien. Ich w�rde ihm deshalb raten, sein ererbtes Reich </p><p>nach M�glichkeit zu pflegen und zu f�rdern und es zu h�chster Bl�te zu </p><p>bringen, seine Untertanen zu lieben und sich von ihnen lieben zu lassen, </p><p>mit ihnen zusammen zu leben, sie mit Milde zu regieren und andere Reiche </p><p>in Frieden zu lassen, da ihm ja schon genug und �bergenug zugefallen </p><p>sei. Mit was f�r Ohren, meinst du, mein Morus, m��te man da wohl meine </p><p>Rede aufnehmen?� </p><p>�Wahrhaftig, nicht mit sehr geneigten�, erwiderte ich. </p><p>�Fahren wir also fort!� sagte er. �Die Ratgeber irgendeines K�nigs </p><p>debattieren und kl�geln mit ihm aus, mit welchen Schelmenstreichen sie </p><p>Gelder f�r ihn aufh�ufen k�nnen. Einer r�t dazu, den Geldwert zu </p><p>erh�hen, wenn der K�nig selber eine Zahlung zu leisten hat, ihn aber </p><p>anderseits unter das rechte Ma� zu senken, wenn ihm eine Zahlung zu </p><p>leisten ist. Auf diese Weise bezahlt er eine gro�e Schuld mit wenig Geld </p><p>und erh�lt f�r eine kleine ausstehende Forderung viel. Ein anderer </p><p>wieder schl�gt vor, eine Kriegsgefahr vorzut�uschen, unter diesem </p><p>Vorwand Geld aufzubringen und dann zum geeignet erscheinenden Zeitpunkt </p><p>Frieden zu schlie�en, und zwar unter feierlichen Zeremonien; dadurch </p><p>solle der breiten Masse des dummen Volkes vorgegaukelt werden, der </p><p>fromme F�rst habe offenbar aus Mitleid kein Menschenblut vergie�en </p><p>wollen. Ein dritter ruft ihm gewisse alte, von Motten angefressene und </p><p>l�ngst nicht mehr angewendete Gesetze ins Ged�chtnis, nach denen sich </p><p>kein Mensch mehr richte, weil sich niemand besinnen k�nne, da� sie </p><p>�berhaupt jemals erlassen worden seien, und er fordert ihn auf, </p><p>Strafgelder f�r diese Nichtbefolgung einzuziehen: kein Ertrag sei </p><p>ergiebiger und zugleich ehrenhafter, da er ja die Maske der </p><p>Gerechtigkeit zur Schau trage. Ein vierter wieder fordert den K�nig auf, </p><p>unter Androhung hoher Geldstrafen eine Menge Verbote zu erlassen, </p><p>zumeist von Handlungen, die nicht den Interessen des Volkes dienen, </p><p>gegen Geld aber Leuten Dispens zu erteilen, deren Privatinteressen ein </p><p>Verbot im Wege steht. Auf diese Weise ernte er den Dank des Volkes und </p><p>habe doppelten Gewinn, einmal aus der Bestrafung der Leute, die ihre </p><p>Erwerbsgier ins Netz lockt, und sodann aus dem Verkauf der Vorrechte an </p><p>andere, f�r um so mehr Geld nat�rlich, je gewissenhafter der F�rst ist; </p><p>denn ein guter Herrscher beg�nstigt nur ungern einen Privatmann zum</p><p>Nachteile seines Volkes und deshalb nur f�r viel Geld. Wieder ein </p><p>anderer sucht den K�nig zu �berreden, Richter anzustellen, die in jeder </p><p>beliebigen Sache zu seinen Gunsten entscheiden; au�erdem solle er sie </p><p>einladen, in seinem Palaste und in seiner Gegenwart �ber seine </p><p>Angelegenheiten zu verhandeln; dann werde keiner seiner Prozesse so </p><p>offensichtlich faul sein, da� nicht einer der Richter, sei es aus Lust </p><p>am Widerspruch oder aus Scheu vor Wiederholung von schon Gesagtem oder </p><p>im Haschen nach der k�niglichen Gunst irgendeinen Ritz entdecken w�rde, </p><p>in den man eine Rechtsverdrehung einklemmen k�nne. Wenn dann erst einmal </p><p>bei Meinungsverschiedenheit der Richter �ber die an sich v�llig klare </p><p>Sache debattiert und die Wahrheit in Frage gestellt werde, so biete sich </p><p>dem K�nig die g�nstige Gelegenheit, das Recht zu seinem eigenen Vorteil </p><p>auszulegen, und die anderen w�rden sich aus Hochachtung oder aus Furcht </p><p>seiner Meinung anschlie�en. Und in diesem Sinne f�llt dann sp�ter der </p><p>Gerichtshof unbedenklich das Urteil; denn es kann ja niemandem an einem </p><p>Vorwand fehlen, sich zugunsten des F�rsten zu entscheiden. Gen�gt es ihm </p><p>doch, da� entweder die Billigkeit f�r ihn spricht oder der Wortlaut des </p><p>Gesetzes oder die gewaltsam verdrehte Auslegung des Sinnes eines </p><p>Schriftst�ckes oder, was gewissenhaften Richtern schlie�lich mehr gilt </p><p>als alle Gesetze, des F�rsten unbestreitbares Recht der obersten </p><p>Entscheidung. Kurz, alle Ratgeber sind der gleichen Ansicht und wirken </p><p>zusammen im Sinne jenes Wortes des Crassus, keine Menge Gold sei gro� </p><p>genug f�r einen F�rsten, der ein Heer unterhalten m�sse. Au�erdem kann </p><p>nach ihrer Meinung ein K�nig gar kein Unrecht tun, mag er es auch noch </p><p>so sehr w�nschen; denn der gesamte Besitz aller seiner Untertanen wie </p><p>auch diese selbst sind, so glauben sie, sein Eigentum, und jedem </p><p>einzelnen geh�rt nur so viel, wie ihm seines K�nigs Gnade noch l��t. Der </p><p>aber mu� gro�en Wert darauf legen, da� dieser Rest m�glichst gering ist; </p><p>denn seine Sicherheit beruht darauf, da� sein Volk nicht durch Reichtum </p><p>oder Freiheit �berm�tig wird, weil beides eine harte und ungerechte </p><p>Herrschaft weniger geduldig ertragen l��t, w�hrend anderseits Armut und </p><p>Not abstumpfen, geduldig machen und den Untertanen in ihrer Bedr�ngnis </p><p>den gro�z�gigen Geistesschwung der Emp�rung nehmen. </p><p>Nun stelle dir wieder vor, ich st�nde jetzt noch einmal auf und </p><p>behauptete, alle diese Pl�ne seien f�r den K�nig unehrenhaft und </p><p>verderblich; denn nicht nur seine Ehre, sondern auch seine Sicherheit </p><p>beruhe weniger auf seinem eigenen Reichtum als auf dem seiner </p><p>Untertanen. Ich w�rde dann weiter ausf�hren, da� sich diese einen K�nig </p><p>nicht in dessen, sondern in ihrem eigenen Interesse w�hlen, um n�mlich, </p><p>dank seiner eifrigen Bem�hung, selber in Ruhe und Sicherheit vor </p><p>Gewalttaten zu leben. Deshalb hat der F�rst, so w�rde ich weiter sagen, </p><p>die Pflicht, mehr auf seines Volkes Wohlergehen als auf sein eigenes </p><p>bedacht zu sein, genau so wie es die Pflicht eines Hirten ist, mehr f�r </p><p>die Ern�hrung seiner Schafe als f�r seine eigene zu sorgen, wenigstens </p><p>in seiner Eigenschaft als Schafhirt. Denn in der Armut des Volkes einen </p><p>Schutz zu sehen, ist, wie schon die Erfahrung lehrt, ein gewaltiger </p><p>Irrtum. Wo k�nnte man n�mlich mehr Zank und Streit finden als unter </p><p>Bettlern? Und wer ist eifriger auf Umsturz bedacht als der, dem seine </p><p>augenblickliche Lage so gar nicht gefallen will? Oder wen beseelt </p><p>schlie�lich ein k�hneres Verlangen nach einem allgemeinen Durcheinander, </p><p>in der Hoffnung auf irgend welchen Gewinn, als den, der nichts mehr zu </p><p>verlieren hat? Sollte nun aber wirklich ein K�nig von seinen Untertanen </p><p>so sehr verachtet oder geha�t werden, da� er sie nicht anders im Zaume </p><p>halten kann, als indem er mit Mi�handlungen, Auspl�nderung und </p><p>G�terparzellierung gegen sie vorgeht und sie an den Bettelstab bringt, </p><p>dann w�re es wirklich besser f�r ihn, er legte seine Herrschaft nieder, </p><p>als da� er sie mit Hilfe solcher K�nste behauptet; sie retten ihm wohl </p><p>den Namen seiner Herrschaft, aber ihrer Erhabenheit geht er bestimmt</p><p>verlustig. Denn es ist eines K�nigs nicht w�rdig, �ber Bettler zu </p><p>herrschen, sondern vielmehr �ber reiche und gl�ckliche Menschen. Eben </p><p>das meint sicherlich der hochgemute und geistig �berlegene Fabricius mit </p><p>der Antwort, er wolle lieber Reichen gebieten als selber reich sein. Und </p><p>in der Tat! Als einzelner in Vergn�gen und Gen�ssen schwimmen, w�hrend </p><p>ringsherum andere seufzen und jammern, das hei�t nicht H�ter eines </p><p>Thrones, sondern eines Kerkers sein. Kurzum: wie es demjenigen Arzte an </p><p>jeder Erfahrung fehlt, der eine Krankheit nur durch eine andere zu </p><p>heilen versteht, so mag der seine v�llige Unf�higkeit zur Herrschaft </p><p>�ber Freie ruhig eingestehen, der das Leben der Staatsb�rger nur dadurch </p><p>zu bessern wei�, da� er ihnen nimmt, was das Leben lebenswert macht. Ja </p><p>wahrhaftig, er soll doch lieber seine Tr�gheit oder seinen Stolz </p><p>aufgeben; denn diese Laster ziehen ihm in der Regel die Verachtung oder </p><p>den Ha� seines Volkes zu. Er soll rechtschaffen von seinen Mitteln leben </p><p>und seine Ausgaben den Einnahmen anpassen. Er soll ferner die Missetaten </p><p>einschr�nken und lieber durch richtige Belehrung seiner Untertanen </p><p>verh�ten, als sie erst anwachsen zu lassen und dann zu bestrafen. </p><p>Gesetze, die gewohnheitsm��ig aus der �bung gekommen sind, soll er nicht </p><p>aufs Geratewohl erneuern, zumal wenn sie schon lange nicht mehr </p><p>angewendet und niemals vermi�t worden sind. Er soll auch niemals f�r ein </p><p>derartiges Vergehen eine Geldstrafe einziehen, was der Richter auch </p><p>einem Privatmanne als unbillig und unlauter untersagen w�rde. Ferner </p><p>w�rde ich jenen Ratgebern ein Gesetz der Macarenser mitteilen, die </p><p>gleichfalls nicht eben weit von Utopia entfernt wohnen. An dem Tage </p><p>seiner Regierungs�bernahme verpflichtet sich n�mlich ihr K�nig unter </p><p>Darbringung feierlicher Opfer eidlich, nie auf einmal mehr als tausend </p><p>Pfund Gold oder den entsprechenden Wert in Silber in seinen Kassen zu </p><p>haben. Diese Bestimmung soll ein vortrefflicher K�nig getroffen haben, </p><p>dem das Wohl seines Landes mehr als sein pers�nlicher Reichtum am Herzen </p><p>lag. Mit dieser Ma�nahme wollte er in seinem Volke einer Geldknappheit </p><p>infolge Anh�ufung einer zu gro�en Geldsumme vorbeugen. Er sah n�mlich </p><p>ein, dieser Betrag werde f�r den Monarchen gro� genug sein zum Kampfe </p><p>gegen die Rebellen und gro� genug f�r die Monarchie zur Abwehr </p><p>feindlicher Angriffe; dagegen sei er nicht gro� genug, um zu Einf�llen </p><p>in fremdes Gebiet Lust zu machen. Das war der haupts�chlichste Grund f�r </p><p>den Erla� des genannten Gesetzes. Der n�chste Grund aber war, da� jener </p><p>K�nig glaubte, auf diese Weise einen Mangel an den Zahlungsmitteln </p><p>verh�tet zu haben, die t�glich im Handelsverkehr der B�rger im Umlauf </p><p>waren. Auch war er der Ansicht, ein K�nig werde bei allen </p><p>unvermeidlichen Ausgaben, die den Staatsschatz �ber das gesetzliche Ma� </p><p>hinaus belasten, keine M�glichkeiten zu einer gewaltsamen Ma�nahme </p><p>suchen. Einen solchen K�nig werden die B�sen f�rchten und die Guten </p><p>lieben. W�rde ich also dies und noch mehr dergleichen bei Leuten </p><p>vorbringen, die leidenschaftlich den entgegengesetzten Grunds�tzen </p><p>huldigen, was f�r tauben Ohren w�rde ich da wohl predigen?� </p><p>�Stocktauben, ohne Zweifel�, erwiderte ich. �Und in der Tat, dar�ber </p><p>wundere ich mich auch gar nicht. Auch will es mir, um die Wahrheit zu </p><p>sagen, nicht angebracht erscheinen, derartige Reden zu halten und solche </p><p>Ratschl�ge zu erteilen, die, wie man sicher wei�, niemals befolgt </p><p>werden. Was k�nnte denn auch der Nutzen einer so ungew�hnlichen Rede </p><p>sein, oder wie sollte sie �berhaupt eine Wirkung aus�ben auf Leute, die </p><p>von einer ganz anderen �berzeugung voreingenommen und tief durchdrungen </p><p>sind? Unter lieben Freunden, im vertraulichen Gespr�ch, ist solches </p><p>theoretisches Philosophieren nicht ohne Reiz, aber in einem Rate von </p><p>F�rsten, wo mit gewichtiger Autorit�t �ber Fragen von Bedeutung </p><p>verhandelt wird, ist f�r so etwas kein Platz.� </p><p>�Da haben wir ja�, rief er, �was ich immer sagte: An F�rstenh�fen will</p><p>man eben von Philosophie nichts wissen.� </p><p>�Gewi߫, erwiderte ich, �es ist wahr: nichts von dieser rein </p><p>theoretischen Philosophie, die da meint, jeder beliebige Satz sei </p><p>�berall am Platze. Aber es gibt ja noch eine andere Art von Philosophie, </p><p>die die besonderen Bedingungen ihres Landes und ihrer Zeit besser kennt. </p><p>Ihr ist die B�hne, auf der sie zu spielen hat, bekannt, sie pa�t sich </p><p>ihr an und f�hrt ihre Rolle in dem St�ck, das gerade gegeben wird, </p><p>gef�llig und mit Anstand durch. Das ist die Philosophie, die f�r dich in </p><p>Betracht kommt. Wie w�re es �brigens, wenn du bei der Auff�hrung einer </p><p>Kom�die des Plautus, gerade w�hrend die Haussklaven untereinander Possen </p><p>treiben, in der Tracht eines Philosophen auf der B�hne erschienest und </p><p>aus der Octavia die Stelle hersagtest, in der Seneca mit Nero </p><p>disputiert? W�re es da nicht besser, du tr�test nur als Statist auf, </p><p>anstatt Unpassendes zu deklamieren und dadurch eine solche Tragikom�die </p><p>vorzuf�hren? Du w�rdest ja das St�ck, das man gerade spielt, verderben </p><p>und �ber den Haufen werfen, indem du so ganz Verschiedenartiges </p><p>durcheinandermengst, selbst wenn das, was du bringst, der wertvollere </p><p>Beitrag w�re. Was f�r ein St�ck gerade aufgef�hrt wird, darin mu�t du so </p><p>gut wie m�glich mitspielen, und du darfst das ganze St�ck nicht deshalb </p><p>in Unordnung bringen, weil dir ein h�bscheres von einem anderen </p><p>Verfasser in den Sinn gekommen ist. </p><p>So ist es im Staate, so bei den Beratungen der F�rsten. Kann man </p><p>verkehrte Meinungen nicht mit der Wurzel ausrotten und kann man �beln, </p><p>die sich durch lange Gewohnheit eingenistet haben, nicht nach seiner </p><p>innersten �berzeugung abhelfen, so darf man deshalb doch nicht gleich </p><p>den Staat im Stiche lassen und im Sturme das Schiff nicht deshalb </p><p>preisgeben, weil man den Winden nicht Einhalt gebieten kann. Man darf </p><p>auch nicht den Menschen eine ungew�hnliche und l�stige Rede aufdr�ngen, </p><p>die, wie man wei�, auf Leute, die entgegengesetzter Meinung sind, gar </p><p>keinen Eindruck machen wird. Man mu� es lieber auf einem Umwege </p><p>versuchen und sich bem�hen, an seinem Teile alles geschickt zu behandeln </p><p>und, was man nicht zum Guten wenden kann, wenigstens zu einem m�glichst </p><p>kleinen �bel werden zu lassen. Denn unm�glich k�nnen alle Verh�ltnisse </p><p>gut sein, solange nicht alle Menschen gut sind. Darauf aber werde ich </p><p>wohl noch manches Jahr warten m�ssen.� </p><p>�Dieses Verhalten�, meinte er, �h�tte nichts anderes zur Folge, als da� </p><p>ich, in dem Bestreben, die Raserei anderer zu heilen, selber mit ihnen </p><p>zu rasen anfinge. Denn wenn ich die Wahrheit sagen will, so mu� ich so </p><p>reden; ob es dagegen eines Philosophen w�rdig ist, die Unwahrheit zu </p><p>sagen, wei� ich nicht. Mir wenigstens widerstrebt es. Es mag schon sein, </p><p>da� meine Rede jenen Leuten vielleicht unwillkommen und l�stig ist. </p><p>Trotzdem aber sehe ich nicht ein, warum sie ihnen bis zur </p><p>Unschicklichkeit ungew�hnlich erscheinen sollte. Wenn ich nun entweder </p><p>das anf�hrte, was Plato in seinem Staate fingiert, oder das, was die </p><p>Utopier in ihrem Staate tun, so k�nnte das, obgleich es an sich das </p><p>Bessere w�re -- und das ist es auch wirklich�--, doch unpassend </p><p>erscheinen, weil es hier Privatbesitz der einzelnen gibt, dort aber </p><p>alles gemeinsamer Besitz aller ist. </p><p>Wie ist es denn nun aber eigentlich mit _meiner_ Rede? Abgesehen davon, </p><p>da� den Leuten, die auf einem anderen Wege kopf�ber vorw�rtsst�rzen </p><p>wollen, ein Mann nicht lieb sein kann, der sie zur�ckruft und auf </p><p>Gefahren aufmerksam macht, was enthielt sie denn sonst, das nicht </p><p>�berall gesagt werden d�rfte oder sogar gesagt werden sollte? M��te man </p><p>freilich alles als unerh�rt und widersinnig beiseite lassen, was </p><p>verkehrter menschlicher Anschauung zufolge als seltsam erscheint, dann</p><p>m��ten wir unter den Christen das meiste von allem geheimhalten, was </p><p>Christus gelehrt und uns so streng zu verleugnen verboten hat, da� er </p><p>uns sogar geboten hat, auch das, was er seinen J�ngern nur ins Ohr </p><p>gefl�stert hatte, �ffentlich auf den D�chern zu verk�nden. Steht doch </p><p>diese Lehre zum gr��ten Teile weit weniger im Einklang mit unseren </p><p>heutigen Sitten als meine Rede, nur da� die Volksredner in ihrer </p><p>Schlauheit, wie mir scheint, deinen Rat befolgt haben. Als sie n�mlich </p><p>sahen, da� die Menschen nur ungern ihr Verhalten der Vorschrift Christi </p><p>anpa�ten, pa�ten sie umgekehrt seine Lehre, als w�re sie biegsam wie ein </p><p>Richtma� aus Blei, den herrschenden Sitten an, damit beides einigerma�en </p><p>wenigstens in �bereinstimmung miteinander gebracht w�rde. Ich kann aber </p><p>nicht einsehen, welchen Nutzen sie damit gestiftet haben, au�er da� die </p><p>Bosheit gr��ere Sicherheit genie�t, und ich selbst w�rde in der Tat in </p><p>dem Rate eines F�rsten ebensowenig Nutzen stiften. Entweder n�mlich </p><p>w�rde ich eine abweichende Meinung �u�ern -- das w�re dann genau so, als </p><p>wenn ich gar nichts sagte�--, oder eine zustimmende, und damit w�rde ich </p><p>zum Helfershelfer ihres Wahnsinns, wie Micio bei Terenz sagt. Denn was </p><p>jenen von dir erw�hnten Umweg anlangt, so kann ich nicht einsehen, was </p><p>f�r eine Bewandtnis es damit haben soll. Du meinst, man m�sse auf ihm zu </p><p>erreichen suchen, da� die Verh�ltnisse, wenn man sie nun einmal nicht </p><p>gr�ndlich bessern kann, wenigstens geschickt behandelt werden und sich, </p><p>soweit das geht, m�glichst wenig schlecht gestalten. Denn von Vertuschen </p><p>kann hier keine Rede sein, und die Augen darf man nicht zudr�cken. Die </p><p>schlechtesten Ratschl�ge sollen offen gebilligt und die verderblichsten </p><p>Verf�gungen unterschrieben werden. Ein Schurke, ja fast ein Hochverr�ter </p><p>w�rde sein, wer unheilvolle Beschl�sse in arglistiger Weise doch </p><p>guthie�e. </p><p>Ferner bietet sich einem gar keine Gelegenheit, sich irgendwie n�tzlich </p><p>zu machen, wenn man unter solche Amtsgenossen ger�t, die auch den </p><p>besten Mann verderben, anstatt sich selbst durch ihn bessern zu lassen. </p><p>Der Umgang mit diesen verdorbenen Menschen wird dich entweder auch </p><p>verderben, oder, wenn du auch selbst unbescholten und ohne Schuld </p><p>bleibst, so wirst du doch fremder Bosheit und Torheit zum Deckmantel </p><p>dienen. So viel fehlt also daran, da� du mit jenem deinen Umwege etwas </p><p>zum Besseren wenden k�nntest. </p><p>Deshalb erkl�rt auch Plato mit einem wundersch�nen Gleichnis, warum sich </p><p>die Weisen mit Fug und Recht von politischer Bet�tigung fernhalten </p><p>sollen. Sie sehen n�mlich, wie das Volk auf die Stra�en str�mt und </p><p>ununterbrochen von Regeng�ssen durchn��t wird, k�nnen es aber nicht dazu </p><p>bewegen, sich vor dem Regen in Sicherheit zu bringen und in die H�user </p><p>zu gehen. Weil sie aber wissen, da� sie, wenn sie auch auf die Stra�e </p><p>gehen, nichts weiter erreichen, als da� sie selbst mit einregnen, so </p><p>bleiben sie im Hause und sind damit zufrieden, wenigstens selber in </p><p>Sicherheit zu sein, wenn sie schon fremder Torheit nicht steuern k�nnen. </p><p>Wenn ich freilich ganz offen meine Meinung kundgeben soll, mein lieber </p><p>Morus, so mu� ich sagen: ich bin in der Tat der Ansicht, �berall, wo es </p><p>noch Privateigentum gibt, wo alle an alles das Geld als Ma�stab anlegen, </p><p>wird kaum jemals eine gerechte und gl�ckliche Politik m�glich sein, es </p><p>sei denn, man will dort von Gerechtigkeit sprechen, wo gerade das Beste </p><p>immer den Schlechtesten zuf�llt, oder von Gl�ck, wo alles unter ganz </p><p>wenige verteilt wird und wo es auch diesen nicht in jeder Beziehung gut </p><p>geht, der Rest aber ein elendes Dasein f�hrt. </p><p>So erw�ge ich denn oft die so klugen und ehrw�rdigen Einrichtungen der </p><p>Utopier, die so wenig Gesetze und trotzdem eine so ausgezeichnete </p><p>Verfassung haben, da� das Verdienst belohnt wird und trotz gleichm��iger</p><p>Verteilung des Besitzes allen alles reichlich zur Verf�gung steht. Und </p><p>dann vergleiche ich im Gegensatz dazu mit ihren Gebr�uchen die so vieler </p><p>anderer Nationen, die nicht aufh�ren zu ordnen, von denen allen aber </p><p>auch nicht eine jemals so richtig in Ordnung ist. Bei ihnen bezeichnet </p><p>jeder, was er erwirbt, als sein Privateigentum; aber ihre so zahlreichen </p><p>Gesetze, die sie tagt�glich erlassen, reichen nicht aus, jemandem den </p><p>Erwerb dessen, was er sein Privateigentum nennt, oder seine Erhaltung </p><p>oder seine Unterscheidung von fremdem Besitz zu sichern, was jene </p><p>zahllosen Prozesse deutlich beweisen, die ebenso ununterbrochen </p><p>entstehen, wie sie niemals aufh�ren. Wenn ich mir das so �berlege, werde </p><p>ich Plato doch besser gerecht und wundere mich weniger dar�ber, da� er </p><p>es verschm�ht hat, f�r jene Leute irgendwelche Gesetze zu erlassen, die </p><p>eine auf Gesetzen beruhende gleichm��ige Verteilung aller G�ter unter </p><p>alle ablehnen. In seiner gro�en Klugheit erkannte er offensichtlich ohne </p><p>weiteres, da� es nur einen einzigen Weg zum Wohle des Staates gibt: die </p><p>Einf�hrung der Gleichheit des Besitzes. Diese ist aber wohl niemals dort </p><p>m�glich, wo die einzelnen ihr Hab und Gut noch als Privateigentum </p><p>besitzen. Denn, wo jeder auf Grund gewisser Rechtsanspr�che an sich </p><p>bringt, soviel er nur kann, teilen nur einige wenige die gesamte Menge </p><p>der G�ter unter sich, mag sie auch noch so gro� sein, und lassen den </p><p>anderen nur Mangel und Not �brig. Und in der Regel ist es so, da� die </p><p>einen in h�chstem Grade das Los der anderen verdienen; denn die Reichen </p><p>sind habgierige, betr�gerische und nichtsnutzige Menschen, die Armen </p><p>dagegen bescheidene und schlichte M�nner, die durch ihre t�gliche Arbeit </p><p>dem Gemeinwesen mehr als sich selbst n�tzen. Ich bin daher der festen </p><p>�berzeugung, das einzige Mittel, auf irgendeine gleichm��ige und </p><p>gerechte Weise den Besitz zu verteilen und die Sterblichen gl�cklich zu </p><p>machen, ist die g�nzliche Aufhebung des Privateigentums. Solange es das </p><p>noch gibt, wird der weitaus gr��te und beste Teil der Menschheit die </p><p>be�ngstigende und unvermeidliche Last der Armut und der K�mmernisse </p><p>dauernd weiterzutragen haben. Sie kann wohl ein wenig erleichtert </p><p>werden, das gebe ich zu; aber sie v�llig zu beseitigen, das ist, so </p><p>behaupte ich, unm�glich. Man k�nnte ja f�r den Besitz des einzelnen an </p><p>Grund und Boden ein bestimmtes H�chstma� festsetzen und ebenso eine </p><p>bestimmte Grenze f�r das Barverm�gen; man k�nnte auch durch Gesetze </p><p>einer zu gro�en Macht des F�rsten und einer zu gro�en Anma�ung des </p><p>Volkes vorbeugen. Ferner k�nnte man die Erlangung von �mtern durch </p><p>allerlei Schliche oder durch Bestechung und die Forderung von Aufwand </p><p>w�hrend der Amtst�tigkeit unterbinden. Andernfalls n�mlich bietet sich </p><p>Gelegenheit, sich das verausgabte Geld durch Betrug und Raub wieder zu </p><p>verschaffen, und man sieht sich gezwungen, reichen Leuten _die_ �mter zu </p><p>geben, die man lieber F�higen h�tte geben sollen. Durch solche Gesetze </p><p>kann man die erw�hnten �belst�nde wohl mildern und abschw�chen, ebenso </p><p>wie man kranke K�rper in hoffnungslosem Zustande durch unabl�ssige warme </p><p>Umschl�ge zu st�rken pflegt. Aber auf eine vollst�ndige Behebung der </p><p>�belst�nde und auf den Eintritt eines erfreulichen Zustandes darf man </p><p>ganz und gar nicht hoffen, solange jeder noch Privateigentum besitzt. </p><p>Ja, w�hrend man an der einen Stelle zu heilen sucht, verschlimmert man </p><p>die Wunde an anderen Stellen. So entsteht abwechselnd aus der Heilung </p><p>des einen die Krankheit des anderen; denn niemandem kann man etwas </p><p>zulegen, was man einem anderen nicht erst weggenommen hat.� </p><p>�Aber ich bin gerade der entgegengesetzten Meinung�, erwiderte ich, �da� </p><p>man sich n�mlich niemals dort wohl f�hlen kann, wo G�tergemeinschaft </p><p>herrscht. Denn wie k�nnte die Menge der G�ter ausreichen, wenn jeder </p><p>sich um die Arbeit dr�ckt, weil ihn ja keine R�cksicht auf Erwerb zur </p><p>Arbeit anspornt und weil ihn die M�glichkeit, sich auf den Flei� anderer </p><p>zu verlassen, tr�ge werden l��t? Aber wenn auch die Not die Menschen zur </p><p>Arbeit anstacheln sollte, w�rde man da nicht dauernd durch Mord und</p><p>Aufruhr in Gefahr schweben, falls niemand auf Grund irgendeines Gesetzes </p><p>das, was er erwirbt, als sein Eigentum sch�tzen k�nnte? Zumal wenn die </p><p>Autorit�t der Beh�rden und die Achtung vor ihnen geschwunden ist, wie </p><p>k�nnte dann f�r beides Platz sein bei Menschen, zwischen denen keinerlei </p><p>Unterschied besteht? Das kann ich mir nicht einmal vorstellen.� </p><p>��ber diese deine Ansichten wundere ich mich gar nicht�, erwiderte </p><p>Raphael; �denn von einem solchen Staate hast du entweder gar keine </p><p>Anschauung oder nur eine falsche. W�rest du jedoch mit mir in Utopien </p><p>gewesen und h�ttest du dort mit eigenen Augen die Sitten und </p><p>Einrichtungen kennengelernt, wie ich es getan habe, der ich �ber f�nf </p><p>Jahre dort gelebt habe und gar nicht wieder h�tte fortgehen m�gen, au�er </p><p>um die Kenntnis von dieser neuen Welt zu verbreiten, so w�rdest du </p><p>entschieden zugeben, du habest nirgends anderswo ein Volk mit einer </p><p>guten Verfassung gesehen au�er dort.� </p><p>�Und doch�, sagte Peter �gid, �wirst du mich in der Tat nur schwer davon </p><p>�berzeugen k�nnen, da� es in jener neuen Welt ein Volk mit besserer </p><p>Verfassung gibt als in dieser uns bekannten. Haben wir doch hier ebenso </p><p>kluge K�pfe, und die Staatswesen sind, meine ich, �lter als dort; auch </p><p>verdanken unsere Kulturg�ter ihre Entstehung zum gr��ten Teile langer </p><p>Erfahrung, wobei ich nicht unerw�hnt lassen will, da� bei uns manches </p><p>durch Zufall entdeckt worden ist, was zu erdenken kein Scharfsinn </p><p>ausgereicht h�tte.� </p><p>��ber das Alter der Staaten w�rdest du richtiger urteilen k�nnen�, </p><p>erwiderte jener, �wenn du die Geschichtswerke �ber jene Welt genau </p><p>gelesen h�ttest. Darf man ihnen glauben, so hat es dort fr�her St�dte </p><p>gegeben als bei uns Menschen. Alles aber, was bis heute der Scharfsinn </p><p>erfunden oder der Zufall entdeckt hat, konnte hier wie dort vorhanden </p><p>sein. Im �brigen ist es meine feste �berzeugung: M�gen wir jenen Leuten </p><p>auch an Gaben des Geistes voraussein, an Eifer und Flei� bleiben wir </p><p>trotzdem weit hinter ihnen zur�ck. Wie n�mlich aus ihren Chroniken </p><p>hervorgeht, hatten sie vor unserer Landung dort niemals etwas von </p><p>unserer Welt geh�rt -- sie nennen uns Ultra�quinoktialen�--, au�er da� </p><p>in alten Zeiten, vor nunmehr 1200 Jahren, in der N�he der Insel Utopia </p><p>ein vom Sturm dorthin verschlagenes Schiff durch Schiffbruch unterging. </p><p>Dabei warfen die Wellen etliche R�mer und �gypter an den Strand, die </p><p>dann nie wieder fortgingen. </p><p>Und nun sieh, wie die Utopier in ihrem Flei�e diese in ihrer Art einzige </p><p>Gelegenheit ausnutzten! Es gab im ganzen r�mischen Reiche keine </p><p>irgendwie n�tzliche Kunstfertigkeit, die sie nicht von den gestrandeten </p><p>Fremdlingen erlernt oder die sie nicht, im Besitze der Keime ihrer </p><p>Kenntnis, weiter ausgebildet h�tten. Von solchem Vorteil war es f�r sie, </p><p>da� auch nur ein einziges Mal ein paar Leute von hier dorthin </p><p>verschlagen wurden. Sollte aber ein �hnlicher gl�cklicher Zufall fr�her </p><p>einmal jemanden von dort hierher gebracht haben, so ist das heute ebenso </p><p>g�nzlich vergessen, wie sich vielleicht sp�tere Geschlechter auch meines </p><p>Aufenthaltes dort nicht mehr erinnern werden. Und w�hrend sich die </p><p>Utopier schon bei der ersten Ber�hrung mit uns alle unsere n�tzlichen </p><p>Erfindungen aneigneten, wird es dagegen lange dauern, bis _wir_ </p><p>irgendeine Einrichtung �bernehmen, die bei ihnen besser ist als bei uns. </p><p>Dies halte ich auch f�r den Hauptgrund daf�r, da� trotz unserer </p><p>geistigen und materiellen �berlegenheit ihr Staat dennoch kl�ger </p><p>verwaltet wird und gl�cklicher aufbl�ht.� </p><p>�Also, mein lieber Raphael�, sagte ich, �so bitte ich dich dringend, gib </p><p>uns eine Beschreibung der Insel und fasse dich nicht zu kurz, sondern</p><p>erl�utere uns der Reihe nach Landschaft, Fl�sse, St�dte, Menschen, </p><p>Sitten, Einrichtungen, Gesetze, kurz alles, was wir, wie du meinst, </p><p>gern kennenlernen wollen! Du kannst aber annehmen, da� wir alles wissen </p><p>m�chten, was wir bis jetzt nicht wissen.� </p><p>�Nichts werde ich lieber tun�, erwiderte er; �denn das habe ich noch </p><p>frisch im Ged�chtnis. Aber die Sache erfordert Zeit.� </p><p>�So wollen wir denn hineingehen�, sagte ich, �und fr�hst�cken; dann </p><p>nehmen wir uns Zeit, ganz wie es uns beliebt!� </p><p>�Einverstanden!� erwiderte er. </p><p>Und so gingen wir ins Haus und fr�hst�ckten. Danach kehrten wir an den </p><p>alten Platz zur�ck und nahmen auf derselben Bank Platz. Den Dienern </p><p>sagte ich, wir wollten von niemandem gest�rt werden. Dann erinnerten </p><p>Peter �gid und ich den Raphael an sein Versprechen. Als er uns nun in </p><p>solcher Spannung und Erwartung sah, sa� er erst eine Weile schweigend </p><p>und nachdenklich da, dann begann er folgenderma�en. </p><p>(Ende des ersten Buches. Es folgt das zweite.) </p><p>ZWEITES BUCH </p><p>Des Raphael Hythlodeus Rede �ber den besten Zustand des Staates </p><p>Von Thomas Morus </p><p>Die Insel der Utopier hat in der Mitte -- da ist sie n�mlich am </p><p>breitesten -- eine Ausdehnung von 200 Meilen, ist �ber eine gro�e </p><p>Strecke hin nicht viel schm�ler und nimmt nach den beiden Enden zu </p><p>allm�hlich ab. Diese runden die ganze Insel zu einem Halbkreise von 500 </p><p>Meilen Umfang ab und geben ihr die Gestalt des zunehmenden Mondes. </p><p>Zwischen den beiden H�rnern befindet sich eine Meeresbucht von etwa elf </p><p>Meilen Breite. Land umgibt diese gewaltige Wasserfl�che auf allen Seiten </p><p>und sch�tzt sie vor Winden. Sie ist weniger st�rmisch bewegt und gleicht </p><p>mehr einem ruhigen See von ungeheurer Ausdehnung, macht fast die ganze </p><p>Ausbuchtung des Landes zu einem Hafen und erm�glicht den Schiffsverkehr </p><p>nach allen Richtungen. </p><p>Die Einfahrt in den Hafen gef�hrden auf der einen Seite Untiefen und auf </p><p>der anderen Klippen. Etwa in der Mitte ragt ein einzelner Felsen empor, </p><p>der aber ungef�hrlich ist. Auf ihm steht ein Turm, in den die Utopier </p><p>eine Besatzung gelegt haben. Die �brigen Klippen sind unsichtbar und </p><p>deshalb gef�hrlich. Die Fahrstra�en kennen nur die Eingeborenen, und so </p><p>kann ein Ausl�nder ohne einen Lotsen aus Utopien nur schwer in diese </p><p>Bucht eindringen; k�nnten doch die Utopier selber kaum ohne Gefahr dort </p><p>einlaufen, wenn nicht gewisse Seezeichen vom Strande aus die Richtung </p><p>ang�ben, und durch ihre Umsetzung w�ren sie imstande, jeder auch noch so </p><p>gro�en feindlichen Flotte den Untergang zu bereiten. </p><p>Auf der anderen Seite liegen gut besuchte H�fen. Aber �berall ist der </p><p>Zugang zum Lande so stark durch Natur oder Kunst befestigt, da� auch nur </p><p>eine Handvoll Verteidiger selbst gewaltige Truppenmassen abwehren </p><p>k�nnte. �brigens war dieses Land, wie man berichtet und wie der</p><p>Augenschein deutlich zeigt, vor Zeiten noch keine Insel. Vielmehr hat </p><p>erst Utopus, der als Eroberer die Insel nach sich benannt hat -- bis </p><p>dahin hie� sie Abraxa -- und der den rohen und unkultivierten Volksstamm </p><p>in Kultur und Gesittung auf eine solche H�he gebracht hat, da� er die </p><p>�brigen V�lker �bertrifft, das Land zur Insel gemacht. Kaum war er </p><p>n�mlich dort gelandet und Herr des Landes geworden, so lie� er eine </p><p>Strecke von 15 Meilen auf der Seite, wo die Halbinsel mit dem Festlande </p><p>zusammenhing, ausstechen und f�hrte so das Meer ringsherum. Da er zu </p><p>dieser Arbeit, um sie nicht als Schmach empfinden zu lassen, nicht nur </p><p>die Eingeborenen zwang, sondern au�erdem alle seine Soldaten hinzuzog, </p><p>verteilte sie sich auf eine gewaltige Menge Menschen, und so wurde das </p><p>Werk mit unglaublicher Schnelligkeit vollendet. Bei den Nachbarv�lkern </p><p>aber, die es anfangs als ein aussichtsloses Beginnen ins L�cherliche </p><p>gezogen hatten, erregte der Erfolg Staunen und Schrecken. </p><p>Die Insel hat 54 St�dte, alle ger�umig und pr�chtig, in Sprache, Sitten, </p><p>Einrichtungen und Gesetzen einander v�llig gleich. Sie sind alle in </p><p>derselben Weise angelegt und haben, soweit das bei der Verschiedenheit </p><p>des Gel�ndes m�glich ist, dasselbe Aussehen. Die geringste Entfernung </p><p>zwischen ihnen betr�gt 24 Meilen; anderseits wieder ist keine so </p><p>abgelegen, da� man nicht von ihr aus eine andere an _einem_ Tage zu Fu� </p><p>erreichen k�nnte. </p><p>Aus jeder Stadt kommen allj�hrlich drei erfahrene Greise in Amaurotum </p><p>zusammen, um sich �ber gemeinsame Angelegenheiten der Insel zu beraten. </p><p>Diese Stadt wird n�mlich als erste und als Hauptstadt betrachtet, weil </p><p>sie gleichsam im Herzen des Landes und somit f�r die Abgeordneten aller </p><p>Landesteile bequem liegt. </p><p>Ackerland ist den St�dten planm��ig zugeteilt, und zwar so, da� einer </p><p>jeden nach jeder Richtung hin mindestens 12 Meilen Anbaufl�che zur </p><p>Verf�gung stehen, nach manchen Richtungen hin jedoch noch viel mehr, </p><p>n�mlich dort, wo die St�dte weiter auseinanderliegen. Keine Stadt ist </p><p>auf Erweiterung ihres Gebietes bedacht; denn die Einwohner betrachten </p><p>sich mehr als seine Bebauer denn als seine Besitzer. </p><p>Auf dem flachen Lande haben die Utopier H�fe, die zweckm��ig �ber die </p><p>ganze Anbaufl�che verteilt und mit landwirtschaftlichen Ger�ten versehen </p><p>sind; in ihnen wohnen B�rger, die abwechselnd dorthin ziehen. Jeder </p><p>l�ndliche Haushalt z�hlt an M�nnern und Frauen mindestens 40 K�pfe, wozu </p><p>noch zwei zur Scholle geh�rige Knechte kommen. Einem Haushalte stehen </p><p>ein Hausvater und eine Hausmutter vor, gesetzte und an Erfahrung reiche </p><p>Personen, und an der Spitze von je 30 Familien steht ein Phylarch. </p><p>Aus jeder Familie wandern j�hrlich 20 Personen in die Stadt zur�ck, </p><p>nachdem sie zwei ganze Jahre auf dem Lande zugebracht haben, und werden </p><p>durch ebensoviel neue aus der Stadt ersetzt. Diese werden dann von </p><p>denen, die schon ein Jahr dort gewesen sind und deshalb gr��ere </p><p>Erfahrung in der Landwirtschaft besitzen, angelernt, um ihrerseits </p><p>wiederum im folgenden Jahre andere zu unterweisen. Dadurch will man </p><p>Fehler in der Getreideversorgung verh�ten, die infolge Mangels an </p><p>Erfahrung gemacht werden k�nnten, wenn alle dort zu gleicher Zeit </p><p>unerfahrene Neulinge w�ren. Diese Sitte, mit den Bebauern zu wechseln, </p><p>ist zwar die gew�hnliche, weil niemand gegen seinen Willen und nur unter </p><p>Zwang das m�hsamere Leben auf dem Lande l�nger ohne Unterbrechung </p><p>zubringen soll; viele jedoch, denen die Landwirtschaft von Natur Freude </p><p>macht, erwirken sich einen Aufenthalt von mehr Jahren. </p><p>Die Ackerbauer bestellen das Land, treiben Viehzucht, beschaffen Holz</p><p>und fahren es bei Gelegenheit zu Wasser oder zu Lande nach der Stadt. </p><p>K�cken ziehen sie in gewaltiger Menge auf, und zwar mit Hilfe einer </p><p>wunderbaren Vorrichtung. Sie lassen n�mlich die H�hnereier nicht von den </p><p>Hennen ausbr�ten, sondern setzen sie in gro�er Zahl einer gleichm��igen </p><p>W�rme aus, erwecken sie dadurch zum Leben und ziehen dann die K�cken </p><p>gro�. Kaum sind diese ausgeschl�pft, so laufen sie den Menschen wie </p><p>ihren M�ttern nach und erkennen sie immer wieder. Pferde ziehen die </p><p>Utopier in ganz geringer Zahl auf, und zwar nur sehr feurige Tiere; sie </p><p>sind einzig und allein f�r �bungen der Jugend in der Reitkunst bestimmt. </p><p>Denn alle Arbeit bei der Feldbestellung oder beim Transport verrichten </p><p>Ochsen. Sie sind zwar, wie die Utopier offen zugeben, nicht so feurig </p><p>wie die Pferde, besitzen aber daf�r ihrer Meinung nach mehr Ausdauer und </p><p>eine gr��ere Widerstandsf�higkeit gegen Krankheiten. Au�erdem erfordert </p><p>ihr Unterhalt weniger Aufwand an M�he und Kosten, und zuletzt sind sie, </p><p>wenn sie ausgedient haben, doch noch f�r die Ern�hrung zu gebrauchen. </p><p>Getreide verwenden die Utopier nur zur Brotbereitung; denn als Getr�nk </p><p>dient ihnen Wein von Trauben oder �pfeln oder Birnen oder schlie�lich </p><p>auch Wasser, das sie bisweilen unvermischt trinken, oft aber auch mit </p><p>Honig oder S��holz verkocht, das es bei ihnen in nicht geringer Menge </p><p>gibt. Den Verbrauch von Lebensmitteln durch die Stadt und ihre Umgebung </p><p>haben sie zwar ermittelt und kennen ihn ganz genau, trotzdem bauen sie </p><p>viel mehr Getreide an und ziehen auch viel mehr Vieh auf, als f�r den </p><p>Eigenbedarf n�tig ist, um dann den �berschu� an ihre Nachbarn abzugeben. </p><p>Alles, was sie an Hausrat brauchen, den es auf dem Lande nicht gibt, </p><p>verlangen sie von der Stadt und erhalten es auch ohne jede Gegenleistung </p><p>bereitwillig von den Beh�rden; denn die meisten von ihnen kommen sowieso </p><p>in jedem Monat an einem Feiertage in der Stadt zusammen. Wenn die </p><p>Erntezeit naht, melden die Phylarchen der Ackerbauer den st�dtischen </p><p>Beh�rden, wieviel B�rger sie ihnen schicken sollen. Diese Schar </p><p>Erntearbeiter trifft am festgesetzten Tage rechtzeitig ein, und bei </p><p>gutem Wetter erledigt man dann so ziemlich an einem einzigen Tage die </p><p>gesamte Erntearbeit. </p><p>Die St�dte, namentlich Amaurotum </p><p>Wer _eine_ Stadt kennt, kennt _alle_: so v�llig �hnlich sind sie </p><p>einander, soweit nicht die Beschaffenheit des Gel�ndes dem </p><p>entgegensteht. Ich will deshalb irgendeine beschreiben; es kommt n�mlich </p><p>wirklich nicht viel darauf an, welche. Aber welche lieber als Amaurotum? </p><p>Denn keine verdient es mehr, da dieser Stadt die �brigen die W�rde als </p><p>Sitz des Senats �bertragen haben und da ich sie infolge meines </p><p>ununterbrochenen f�nfj�hrigen Aufenthaltes dort besser als jede andere </p><p>kenne. </p><p>Amaurotum also liegt am flachen Abhange eines Berges und ist fast </p><p>quadratisch angelegt. Denn in voller Breite beginnt die Stadt ein wenig </p><p>unterhalb des Gipfels und erstreckt sich etwa zwei Meilen weit bis zum </p><p>Flusse Anydrus, wobei sie sich l�ngs des Ufers betr�chtlich l�nger </p><p>hinzieht. Der Anydrus entspringt aus einer schwachen Quelle 80 Meilen </p><p>oberhalb Amaurotums, wird dann durch den Zuflu� anderer Wasserl�ufe, </p><p>darunter zweier von mittlerer Gr��e, wasserreicher und breiter und ist </p><p>vor der Stadt selbst eine halbe Meile breit. Bald darauf nimmt er an </p><p>Breite noch mehr zu und m�ndet dann 60 Meilen weiter in den Ozean. Auf </p><p>dieser ganzen Strecke zwischen der Stadt und dem Meere sowie noch ein </p><p>paar Meilen oberhalb der Stadt hemmen Ebbe und Flut in ihrem </p><p>sechsst�ndigen Wechsel den schnellen Lauf des Flusses. Wenn die </p><p>Meeresflut 30 Meilen tief eindringt, dr�ngt sie das Wasser des Flusses</p><p>zur�ck und f�llt sein Bett vollst�ndig mit ihren Wellen. Das Flu�wasser </p><p>nimmt dann noch ein ganzes St�ck weiter stromaufw�rts den Salzgeschmack </p><p>des Meeres an; von da ab wird es allm�hlich wieder s��, flie�t klar </p><p>durch die Stadt und dr�ngt der bei Ebbe zur�ckstr�menden Flut fast bis </p><p>zur M�ndung rein und unvermischt nach. </p><p>Die Br�cke, die Amaurotum mit dem gegen�berliegenden Ufer verbindet, </p><p>besteht nicht aus h�lzernen Pfeilern und Balken, sondern ist ein </p><p>Steinbau mit einem wundersch�nen Br�ckenbogen. Sie befindet sich an der </p><p>Stelle, die vom Meere am weitesten entfernt ist, damit die Schiffe an </p><p>dieser ganzen Seite der Stadt ungehindert entlangfahren k�nnen. </p><p>Es gibt dort noch einen anderen Wasserlauf, der zwar nur klein, aber </p><p>recht ruhig und erfreulich ist. Er entspringt auf demselben Berge, auf </p><p>dem die Stadt liegt, flie�t mitten durch sie und m�ndet in den Anydrus. </p><p>Weil seine Quelle ein St�ck au�erhalb der Stadt liegt, haben sie die </p><p>Amaurotaner ringsum mit Befestigungen umgeben, die bis zur Stadt </p><p>reichen. So geh�rt die Quelle zur Stadt, und beim Einbruch einer </p><p>feindlichen Macht kann das Wasser nicht abgefangen und abgelenkt oder </p><p>verdorben werden. Von dort aus leitet man es in R�hren aus gebranntem </p><p>Stein in verschiedenen Richtungen zu den unteren Stadtteilen. L��t das </p><p>irgendwo die Beschaffenheit des Gel�ndes nicht zu, so sammelt man in </p><p>ger�umigen Zisternen das Regenwasser, das dann den gleichen Dienst </p><p>leistet. </p><p>Eine hohe und breite Mauer mit zahlreichen T�rmen und Schutzwehren </p><p>umgibt die Stadt auf allen Seiten; ein trockener, aber tiefer, breiter </p><p>und durch Dorngestr�pp unwegsamer Graben umzieht die Stadtmauer auf drei </p><p>Seiten; auf der vierten dient der Flu� selbst als Wehrgraben. </p><p>Die Stra�en sind ebenso zweckm��ig f�r den Wagenverkehr wie f�r den </p><p>Windschutz angelegt. Die H�user sind keineswegs unansehnlich; man </p><p>�bersieht ihre lange und l�ngs der ganzen Stra�e ununterbrochene Reihe </p><p>von der gegen�berliegenden H�userfront aus. Der Weg zwischen diesen </p><p>beiden Fronten ist 30 Fu� breit. An der R�ckseite der H�user zieht sich </p><p>die ganze Stra�e entlang eine breite Gartenanlage hin, die von der </p><p>R�ckseite anderer H�userreihen eingez�unt ist. </p><p>Jedes Haus hat einen Eingang von der Stra�e her und eine Hintert�r, die </p><p>in den Garten f�hrt. Die T�ren haben zwei Fl�gel, lassen sich durch </p><p>einen leisen Druck mit der Hand �ffnen und schlie�en sich dann von </p><p>selbst wieder, so da� ein jeder ins Haus hinein kann: so wenig ist </p><p>irgendwo etwas Eigentum eines einzelnen; denn sogar die H�user wechselt </p><p>man alle zehn Jahre, und zwar verlost man sie. </p><p>Auf die erw�hnten G�rten halten die Utopier gro�e St�cke. In ihnen haben </p><p>sie Wein, Obst, Gem�se und Blumen in solcher Pracht und Pflege, da� es </p><p>alles �bertrifft, was ich irgendwo an Fruchtbarkeit und gutem Geschmack </p><p>gesehen habe. Ihren Eifer dabei spornt nicht blo� ihr Vergn�gen an der </p><p>Gartenarbeit an, sondern auch der Wettstreit der Stra�enz�ge in der </p><p>Pflege der einzelnen G�rten. Und sicherlich wird man nicht leicht in der </p><p>ganzen Stadt etwas finden, was f�r die B�rger n�tzlicher oder </p><p>unterhaltsamer w�re, und, wie es scheint, hat deshalb auch der Gr�nder </p><p>des Reiches auf nichts gr��ere Sorgfalt verwendet als auf derartige </p><p>G�rten. </p><p>Wie es n�mlich hei�t, hat Utopus selber gleich von Anfang an diesen </p><p>ganzen Plan der Stadt festgelegt. Die Ausschm�ckung jedoch und den </p><p>weiteren Ausbau �berlie� er den Nachkommen in der Erkenntnis, da� _ein_</p><p>Menschenalter dazu nicht ausreichen werde. Daher steht in den </p><p>Geschichtsb�chern der Utopier, die die Geschichte von 1760 Jahren seit </p><p>Eroberung der Insel umfassen, flei�ig und gewissenhaft geschrieben sind </p><p>und von ihnen aufbewahrt werden, die H�user seien im Anfang niedrig </p><p>gewesen, eine Art Baracken und H�tten, ohne Sorgfalt aus irgendwelchem </p><p>Holz errichtet, die W�nde mit Lehm verschmiert, mit spitzen Giebeln und </p><p>Strohd�chern. Aber heutzutage ist jedes Haus ein stattlicher Bau von </p><p>drei Stockwerken; die Au�enseite der W�nde besteht aus Granit oder einer </p><p>anderen harten oder auch gebrannten Steinmasse, die inwendig mit Schutt </p><p>ausgef�llt wird. Die D�cher sind flach und mit einer gewissen Stuckmasse </p><p>belegt, die nicht teuer, aber so zusammengesetzt ist, da� sie nicht </p><p>brennt und noch wetterfester als Blei ist. Vor den Winden sch�tzen sich </p><p>die Utopier durch Fenster aus Glas, das dort sehr viel verwendet wird; </p><p>bisweilen benutzen sie auch an dessen Stelle d�nne Leinwand, die sie mit </p><p>durchsichtigem �l oder einer Bernsteinmasse bestreichen. Das hat den </p><p>doppelten Vorteil, da� mehr Licht und weniger Wind durchgelassen wird. </p><p>Die Obrigkeiten </p><p>Je drei�ig Familien w�hlen sich allj�hrlich einen Vorsteher; in der </p><p>alten Landessprache hei�t er Syphogrant, in der j�ngeren Phylarch. Zehn </p><p>Syphogranten mit ihren Familien unterstehen einem Vorgesetzten, der </p><p>jetzt Protophylarch genannt wird, in alten Zeiten aber Tranibore hie�. </p><p>Schlie�lich ernennen die Syphogranten in ihrer Gesamtheit, zweihundert </p><p>an der Zahl, auch den B�rgermeister. Nachdem sie sich eidlich </p><p>verpflichtet haben, den nach ihrer Ansicht T�chtigsten zu w�hlen, </p><p>ernennen sie auf Grund geheimer Abstimmung einen der vier B�rger, die </p><p>ihnen das Volk namhaft macht, zum B�rgermeister; jedes Stadtviertel </p><p>w�hlt n�mlich einen und schl�gt ihn dem Senat vor. Das Amt wird auf </p><p>Lebenszeit verliehen, wenn dem nicht der Verdacht entgegensteht, es </p><p>gel�ste den Inhaber nach Alleinherrschaft. Die Traniboren w�hlt man </p><p>j�hrlich, doch wechselt man mit ihnen nicht ohne triftige Gr�nde. Die </p><p>�brigen Beamten werden alle auf ein Jahr gew�hlt. Alle drei Tage, im </p><p>Bedarfsfalle bisweilen auch �fter, kommen die Traniboren mit dem </p><p>B�rgermeister zu einer Beratung zusammen, besprechen Stadtangelegenheiten </p><p>und entscheiden rasch etwa vorliegende Privatstreitigkeiten, die </p><p>�brigens ganz selten sind. Zu den Senatssitzungen werden regelm��ig zwei </p><p>Syphogranten hinzugezogen, die jeden Tag wechseln; dabei ist vorgesehen, </p><p>da� keine st�dtische Angelegenheit entschieden wird, �ber die nicht drei </p><p>Tage vor der Beschlu�fassung im Senat verhandelt worden ist. Au�erhalb </p><p>des Senats oder der Volksversammlungen �ber allgemeine Angelegenheiten </p><p>zu beraten, ist bei Todesstrafe verboten. Diese Bestimmung soll eine </p><p>tyrannische Unterdr�ckung des Volkes und eine �nderung der Verfassung </p><p>durch eine Verschw�rung des B�rgermeisters und der Traniboren </p><p>erschweren. Und eben deshalb wird auch jede wichtige Angelegenheit vor </p><p>die Versammlungen der Syphogranten gebracht; diese besprechen sie mit </p><p>den Familien, beraten dann unter sich und teilen ihre Entscheidung dem </p><p>Senat mit. Zuweilen kommt die Sache vor den Rat der ganzen Insel. Auch </p><p>ist es eine Gewohnheit des Senats, �ber einen Antrag nicht gleich an dem </p><p>Tage zu beraten, an dem er zum ersten Male eingebracht wird, sondern die </p><p>Verhandlung auf die n�chste Sitzung zu verschieben. Es soll n�mlich </p><p>niemand unbedachtsam mit dem herausplatzen, was ihm zuerst auf die Zunge </p><p>kommt, und dann mehr auf die Verteidigung seiner Ansicht als auf das </p><p>Interesse der Stadt bedacht sein. Auch soll niemand das Gemeinwohl der </p><p>Erhaltung der guten Meinung von seiner Person opfern, in einer Art </p><p>sinnloser und verkehrter Scham, weil er sich nicht merken lassen will, </p><p>da� er es im Anfang an der n�tigen Voraussicht hat fehlen lassen, </p><p>w�hrend er doch von vornherein darauf h�tte bedacht sein m�ssen, lieber</p><p>�berlegt als rasch zu sprechen. </p><p>Die Handwerke </p><p>_Ein_ Gewerbe betreiben alle, M�nner und Frauen ohne Unterschied: den </p><p>Ackerbau, und auf ihn versteht sich jedermann. Von Jugend auf werden sie </p><p>darin unterwiesen, zum Teil durch Unterricht in den Schulen, zum Teil </p><p>auch auf den Feldern in der N�he der Stadt, wohin man sie wie zu einem </p><p>Spiele f�hrt. Hier sehen sie der Arbeit nicht blo� zu, sondern �ben sie </p><p>auch aus und st�rken bei dieser Gelegenheit zugleich ihre K�rperkr�fte. </p><p>Neben der Landwirtschaft, die, wie gesagt, alle betreiben, erlernt jeder </p><p>noch irgendein Handwerk als seinen besonderen Beruf. Das ist in der </p><p>Regel entweder die Tuchmacherei oder die Leineweberei oder das Maurer- </p><p>oder das Zimmermanns- oder das Schmiedehandwerk. In keinem anderen </p><p>Berufe n�mlich ist dort eine nennenswerte Anzahl Menschen besch�ftigt. </p><p>Denn der Schnitt der Kleidung ist, abgesehen davon, da� sich die </p><p>Geschlechter sowie die Ledigen und die Verheirateten in der Tracht </p><p>voneinander unterscheiden, auf der ganzen Insel einheitlich und stets </p><p>der gleiche in jedem Lebensalter, wohlgef�llig f�rs Auge, bequem f�r die </p><p>K�rperbewegung und vor allem f�r K�lte und Hitze berechnet. Diese </p><p>Kleidung fertigt sich jede Familie selber an. Von den obenerw�hnten </p><p>anderen Gewerben aber erlernt jeder eins, und zwar nicht nur die M�nner, </p><p>sondern auch die Frauen. Letztere jedoch, als die k�rperlich </p><p>Schw�cheren, �ben nur die leichteren Gewerbe aus; in der Regel </p><p>verarbeiten sie Wolle und Flachs; den M�nnern weist man die �brigen, </p><p>m�hsameren Besch�ftigungen zu. Meistenteils erlernt jeder das v�terliche </p><p>Handwerk; denn dazu neigen die meisten von Natur. Hat aber jemand zu </p><p>einem anderen Berufe Neigung, so nimmt ihn durch Adoption eine Familie </p><p>auf, die dasjenige Gewerbe betreibt, zu dem er Lust hat. Dabei sorgen </p><p>nicht nur sein Vater, sondern auch die Beh�rden daf�r, da� er zu einem </p><p>w�rdigen und ehrbaren Familienvater kommt. Ja, wenn jemand _ein_ </p><p>Handwerk gr�ndlich erlernt hat und noch ein anderes dazu erlernen will, </p><p>so ist ihm das auf demselben Wege m�glich. Versteht er dann beide, so </p><p>�bt er aus, welches er will, es sei denn, da� die Stadt eins von beiden </p><p>n�tiger braucht. </p><p>Die besondere und beinahe einzige Aufgabe der Syphogranten ist es, sich </p><p>angelegentlich darum zu k�mmern, da� niemand unt�tig herumsitzt, sondern </p><p>da� jeder sein Gewerbe mit Flei� betreibt, ohne sich jedoch, gleich </p><p>einem Lasttiere, in ununterbrochener Arbeit vom fr�hesten Morgen an bis </p><p>in die tiefe Nacht abzum�hen; denn das w�re eine mehr als sklavische </p><p>Plackerei. Und doch ist das fast �berall das Los der Arbeiter, au�er bei </p><p>den Utopiern. Diese teilen n�mlich den Tag mitsamt der Nacht in </p><p>vierundzwanzig gleiche Stunden ein und kennen eine Arbeitszeit von nur </p><p>sechs Stunden. Drei Stunden arbeiten sie am Vormittag; danach essen sie </p><p>zu Mittag und halten eine Rast von zwei Stunden. Dann arbeiten sie </p><p>wieder drei Stunden und beschlie�en den Tag mit dem Abendessen. Da sie </p><p>die erste Stunde von Mittag an rechnen, gehen sie gegen acht Uhr zu </p><p>Bett; acht Stunden brauchen sie zum Schlafen. </p><p>�ber all die Zeit zwischen den Stunden der Arbeit, des Schlafes und des </p><p>Essens darf ein jeder nach seinem Belieben verf�gen, nicht etwa um sie </p><p>durch Schwelgerei und Tr�gheit schlecht auszun�tzen, sondern um die </p><p>arbeitsfreie Zeit nach Herzenslust auf irgendeine andere Besch�ftigung </p><p>nutzbringend zu verwenden. Die meisten treiben in diesen Pausen </p><p>literarische Studien. Es herrscht n�mlich der Brauch, t�glich in den </p><p>fr�hen Morgenstunden �ffentliche Vorlesungen zu halten; zu ihrem Besuche</p><p>sind diejenigen verpflichtet, die zu wissenschaftlicher Arbeit </p><p>namentlich ausgew�hlt sind. Aus jedem Stande aber str�mt eine gewaltige </p><p>Menge H�rer, M�nner wie Frauen, zu den Vorlesungen, die einen zu diesen, </p><p>die anderen zu jenen, je nach ihren pers�nlichen Neigungen. Wenn jedoch </p><p>einer auch diese Zeit lieber auf seine berufliche T�tigkeit verwenden </p><p>will, was bei vielen der Fall ist, deren Geist sich nicht zur H�he </p><p>wissenschaftlicher Betrachtung erhebt, so hindert man ihn nicht daran; </p><p>er erntet vielmehr sogar noch Lob, weil er sich dem Staate n�tzlich </p><p>macht. </p><p>Nach dem Abendessen verbringen die Utopier noch eine Stunde mit Spielen, </p><p>w�hrend des Sommers in ihren G�rten, w�hrend des Winters aber in jenen </p><p>S�len, in denen sie gemeinsam essen. Entweder treiben sie dort Musik, </p><p>oder sie erholen sich in der Unterhaltung. Das W�rfeln und andere solche </p><p>ungeh�rige und verderbliche Spiele sind ihnen nicht einmal bekannt; </p><p>�blich jedoch sind bei ihnen zwei dem Schach nicht un�hnliche Spiele. </p><p>Das eine ist der Zahlenkampf, bei dem die Zahlen einander stechen; bei </p><p>dem anderen k�mpfen, in Schlachtreihe aufgestellt, die Tugenden mit den </p><p>Lastern. In diesem Spiele zeigt sich sehr h�bsch der Streit der Laster </p><p>untereinander und ihre einm�tige Verbundenheit gegen die Tugenden, </p><p>ebenso welche Laster und Tugenden einander entgegengesetzt sind, mit </p><p>welchen Kr�ften ferner die Laster offen gegen die Tugenden k�mpfen und </p><p>mit welchen R�nken und Listen sie versteckt angreifen, mit welchen </p><p>Hilfsmitteln anderseits die Tugenden die Kr�fte des Lasters brechen, mit </p><p>welchen K�nsten sie ihre Versuchungen vereiteln und auf welche Weise </p><p>endlich die eine oder die andere Partei den Sieg davontr�gt. </p><p>Um aber einer irrt�mlichen Auffassung eurerseits vorzubeugen, m�ssen wir </p><p>an dieser Stelle einen Punkt genauer betrachten. Wenn die Utopier </p><p>n�mlich nur sechs Stunden arbeiten, k�nnte man vielleicht meinen, es </p><p>m�sse das einen Mangel an den notwendigen G�tern zur Folge haben. Aber </p><p>gerade das Gegenteil ist der Fall. Diese Arbeitszeit gen�gt nicht nur, </p><p>sondern wird nicht einmal ganz gebraucht zur Produktion eines Vorrats an </p><p>allem, was zu den Bed�rfnissen oder Annehmlichkeiten des Lebens geh�rt. </p><p>Das werdet auch ihr einsehen, wenn ihr euch �berlegt, ein wie gro�er </p><p>Teil des Volkes in anderen L�ndern unt�tig dahinlebt: erstens fast alle </p><p>Frauen, also die H�lfte der Gesamtheit, oder wenn irgendwo die Frauen </p><p>arbeiten, schnarchen dort meistens an ihrer Stelle die M�nner; au�erdem </p><p>dann die Priester und die sogenannten frommen M�nner, was f�r eine </p><p>gro�e und faule Schar ist das! Nimm noch all die Reichen und besonders </p><p>die Grundbesitzer dazu, die man allgemein als Standespersonen und </p><p>Edelleute bezeichnet! Zu ihnen rechne noch ihre Dienerschaft, jenen </p><p>ganzen zusammengesp�lten Haufen von Raufbolden und Windbeuteln! Vergi� </p><p>schlie�lich auch die kr�ftigen und gesunden Bettler nicht, die ihren </p><p>M��iggang mit irgendeinem Gebrechen bem�nteln, und die Zahl der Leute, </p><p>die durch ihre T�tigkeit f�r die gesamten Bed�rfnisse der Sterblichen </p><p>sorgen, wirst du dann viel geringer finden, als du angenommen hast. Und </p><p>nun �berlege dir, wie wenige von diesen selbst mit wirklich notwendigen </p><p>Arbeiten besch�ftigt sind! Da n�mlich bei uns das Geld der Ma�stab f�r </p><p>alles ist, m�ssen wir viele v�llig unn�tze und �berfl�ssige Gewerbe </p><p>betreiben, die blo� der Verschwendung und der Genu�sucht dienen. W�rde </p><p>man n�mlich diese ganze Masse, die jetzt im Arbeitsproze� steht, nur auf </p><p>die so wenigen Gewerbe verteilen, die ein angemessener nat�rlicher </p><p>Bedarf erfordert, so w�rde ein gro�er �berflu� an Waren entstehen, und </p><p>die Preise w�rden notwendigerweise zu tief sinken, als da� die </p><p>Handwerker ihren Lebensunterhalt davon bestreiten k�nnten. Aber wenn </p><p>alle die, die jetzt ihre Kr�fte in nutzloser T�tigkeit verzetteln, und </p><p>wenn noch dazu der ganze Schwarm derer, die jetzt in Nichtstun und </p><p>Tr�gheit erschlaffen und von denen jeder einzelne so viel von den</p><p>Produkten verbraucht, die die Arbeitskraft anderer liefert, wie zwei der </p><p>Arbeiter, wenn man also alle diese zu Arbeiten, und zwar zu n�tzlichen, </p><p>verwendete, so w�rde, wie leicht einzusehen ist, ungemein wenig Zeit </p><p>mehr als reichlich gen�gen, um alles zu beschaffen, was zum Leben </p><p>notwendig oder n�tzlich ist; du kannst auch noch hinzusetzen, zum </p><p>Vergn�gen, soweit es echt und nat�rlich ist. Und das best�tigen in </p><p>Utopien die Tatsachen selber. Denn dort sind in einer ganzen Stadt </p><p>einschlie�lich ihrer n�chsten Umgebung aus der Gesamtzahl der nach Alter </p><p>und Kr�ften zur Arbeit tauglichen M�nner und Frauen kaum f�nfhundert von </p><p>ihr befreit. Unter ihnen sind die Syphogranten zwar nach dem Gesetz zur </p><p>Arbeit nicht verpflichtet, sie machen aber von dieser Bestimmung keinen </p><p>Gebrauch, um die anderen durch ihr Beispiel um so leichter zur Arbeit </p><p>anzuspornen. Dieselbe Verg�nstigung genie�en diejenigen, denen das Volk </p><p>auf Vorschlag der Priester und auf Grund geheimer Abstimmung der </p><p>Syphogranten dauernde Arbeitsbefreiung zur Durchf�hrung ihrer Studien </p><p>bewilligt. Erf�llt einer von ihnen die auf ihn gesetzte Hoffnung nicht, </p><p>so st��t man ihn wieder unter die Handarbeiter zur�ck. Nicht selten </p><p>tritt aber auch das Gegenteil ein, da� n�mlich ein Handwerker jene </p><p>freien Stunden so eifrig auf das Studium verwendet und durch seinen </p><p>Flei� so gro�e Fortschritte macht, da� man ihn von der Handarbeit </p><p>befreit und in die Klasse der Gebildeten aufr�cken l��t. Aus deren </p><p>Stande nimmt man die Gesandten, Priester, Traniboren und schlie�lich den </p><p>B�rgermeister selber, den die Utopier in ihrer alten Sprache Barzanes </p><p>und in ihrer j�ngeren Ademus nennen. Da nun fast die ganze �brige Masse </p><p>des Volkes weder unt�tig noch mit unn�tzen Gewerben besch�ftigt ist, </p><p>kann man leicht ermessen, in wie wenigen Stunden viel n�tzliche Arbeit </p><p>geleistet wird. </p><p>Zu dem von mir Erw�hnten kommt f�r die Utopier noch die Erleichterung </p><p>hinzu, da� bei ihnen die meisten unentbehrlichen Gewerbe weniger Arbeit </p><p>als bei anderen V�lkern erfordern. Erstens n�mlich ist bei diesen zum </p><p>Bau oder zur Ausbesserung von Geb�uden deshalb so vieler H�nde Arbeit </p><p>dauernd notwendig, weil der zu wenig wirtschaftliche Erbe das Haus, das </p><p>sein Vater erbaut bat, allm�hlich verfallen l��t. Was er mit ganz </p><p>geringen Kosten h�tte erhalten k�nnen, mu� sein Nachfolger mit gro�en </p><p>Kosten erneuern. Ja, h�ufig sagt auch ein Haus, das dem einen ungeheuer </p><p>viel Geld gekostet hat, dem verw�hnten Geschmack des anderen nicht zu. </p><p>Da sich dieser nicht darum k�mmert, verf�llt es in kurzer Zeit, und sein </p><p>Besitzer baut sich an anderer Stelle ein neues Haus f�r nicht weniger </p><p>Geld. Aber bei den Utopiern kommt es, dank der allgemeinen Ordnung und </p><p>dank ihrer Verfassung, nur ganz selten vor, da� man einen neuen Platz </p><p>f�r den Bau eines Hauses sucht. Und sie beheben nicht nur rasch die </p><p>vorhandenen Sch�den, sondern beugen auch drohenden vor. Infolgedessen </p><p>bleiben ihre Geb�ude bei ganz geringem Aufwand an Arbeit �beraus lange </p><p>erhalten, und die Bauhandwerker haben bisweilen kaum etwas zu tun, au�er </p><p>da� sie angewiesen werden, daheim Bauholz zu bearbeiten und bisweilen </p><p>Steine quadratisch zu behauen und fertigzumachen, damit gegebenenfalls </p><p>ein Haus schneller hochkommt. </p><p>Beachte ferner, wie wenig Arbeit zur Anfertigung der Kleidung der </p><p>Utopier erforderlich ist! Zun�chst tragen sie bei der Arbeit einfach </p><p>Leder oder Felle, die bis zu sieben Jahren halten. Beim Ausgehen ziehen </p><p>sie einen mantel�hnlichem Rock �ber, der jene gr�beren Unterkleider </p><p>verdeckt. Diese R�cke haben auf der ganzen Insel die gleiche Farbe, und </p><p>zwar die Naturfarbe des Stoffes. Die Utopier verbrauchen also nicht blo� </p><p>viel weniger wollenes Tuch, als das anderswo der Fall ist, sondern der </p><p>Stoff kostet ihnen auch viel weniger. Aber noch weniger Arbeit macht die </p><p>Herstellung von Leinwand, und deshalb tr�gt man sie auch noch mehr. Beim </p><p>Leinen sieht man nur auf Wei�e, bei der Wolle nur auf Sauberkeit;</p><p>feinere Webart wird gar nicht bezahlt. Und w�hrend sonst nirgends </p><p>_einer_ Person vier oder f�nf wollene Oberkleider von verschiedener </p><p>Farbe und ebenso viele Untersachen aus Seide gen�gen -- etwas </p><p>eleganteren Leuten nicht einmal zehn�--, begn�gt sich hier in Utopien </p><p>ein jeder mit nur einem Anzug, und zwar zumeist f�r zwei Jahre. Warum </p><p>sollte sich dort jemand auch mehr Kleidung w�nschen? Wenn er sie n�mlich </p><p>bek�me, w�re er weder besser vor der K�lte gesch�tzt, noch w�rde er in </p><p>seiner Kleidung auch nur um ein Haar h�bscher aussehen. </p><p>Da die Utopier also alle in n�tzlichen Gewerben besch�ftigt sind und </p><p>diese selbst auch eine geringere Arbeitszeit erfordern, braucht man sich </p><p>nicht zu wundern, da� bisweilen alle Erzeugnisse im �berflu� vorhanden </p><p>sind. Dann f�hrt man eine ungeheure Menge Arbeiter zur Ausbesserung </p><p>�ffentlicher Stra�en, die schadhaft geworden sind, aus der Stadt hinaus; </p><p>sehr oft setzt man aber auch, wenn sich keinerlei Arbeit der Art n�tig </p><p>macht, die Arbeitszeit von Staats wegen herab. Die Beh�rden zwingen </p><p>n�mlich die B�rger nicht zu unn�tiger Arbeit; denn die Einrichtung </p><p>dieses Staates hat das eine Hauptziel im Auge, soweit es die dringenden </p><p>Bed�rfnisse des Staates erlauben, den Sklavendienst des K�rpers nach </p><p>M�glichkeit einzuschr�nken, damit die dadurch gewonnene Zeit auf die </p><p>freie Ausbildung des Geistes verwendet werden kann. Darin liegt n�mlich </p><p>nach ihrer Ansicht das Gl�ck das Lebens. </p><p>Der Verkehr der Utopier miteinander </p><p>Doch glaube ich nunmehr darlegen zu m�ssen, auf welche Weise die B�rger </p><p>miteinander verkehren, welche inneren wirtschaftlichen Beziehungen </p><p>bestehen und wie die Verteilung der G�ter vor sich geht. </p><p>Die B�rgerschaft besteht also aus Familien, die zumeist aus Verwandten </p><p>zusammengesetzt sind. Denn sobald die Frauen k�rperlich reif sind, </p><p>werden sie verheiratet und ziehen dann in die Wohnungen ihrer M�nner. </p><p>Dagegen verbleiben die S�hne und deren m�nnliche Nachkommen in ihren </p><p>Familien und unterstehen der Gewalt des Familien�ltesten, soweit dieser </p><p>nicht infolge seines Alters kindisch geworden ist; dann tritt der </p><p>N�chst�lteste an seine Stelle. Um aber eine zu starke Abnahme oder eine </p><p>�berm��ig gro�e Zunahme der Bev�lkerung zu verhindern, darf keine </p><p>Familie, deren es in jeder Stadt -- die in dem zugeh�rigen Landbezirk </p><p>nicht mitgerechnet -- 6000 gibt, weniger als zehn und mehr als sechzehn </p><p>Erwachsene haben; die Zahl der Kinder kann man ja nicht im voraus </p><p>festsetzen. Diese Bestimmung l��t sich mit Leichtigkeit </p><p>aufrechterhalten, indem man die �berz�hligen Mitglieder der �bergro�en </p><p>Familien in zu kleine versetzt. </p><p>Sollte aber einmal eine ganze Stadt mehr Einwohner haben, als sie haben </p><p>darf, so f�llt man mit dem �berschu� die Einwohnerzahl geringer </p><p>bev�lkerter St�dte des Landes auf. Wenn aber etwa die Menschenmasse der </p><p>ganzen Insel mehr als billig anschwellen sollte, so bestimmt man aus </p><p>jeder Stadt ohne Ausnahme B�rger, die auf dem n�chstgelegenen Festlande </p><p>�berall da, wo viel �berfl�ssiges Ackerland der Eingeborenen brachliegt, </p><p>eine Kolonie nach ihren heimischen Gesetzen einrichten unter </p><p>Hinzuziehung der Einwohner des Landes, falls sie mit ihnen zusammenleben </p><p>wollen. Mit diesen zu gleicher Lebensweise und zu gleichen Sitten </p><p>vereint, verwachsen sie dann leicht miteinander, und das ist f�r beide </p><p>V�lker von Vorteil. Sie erreichen es n�mlich durch ihre Einrichtungen, </p><p>da� ein Land, das vorher dem einen Volke zu klein und unergiebig </p><p>erschien, jetzt f�r beide V�lker mehr als genug hervorbringt. Diejenigen </p><p>Eingeborenen aber, die es ablehnen, nach den Gesetzen der Kolonisten zu</p><p>leben, vertreiben diese aus dem Gebiet, das sie selber f�r sich in </p><p>Anspruch nehmen, und gegen die, die Widerstand leisten, greifen sie zu </p><p>den Waffen. Denn das ist nach Ansicht der Utopier der gerechteste </p><p>Kriegsgrund, wenn irgendein Volk die Nutznie�ung und den Besitz eines </p><p>St�ckes Land, das es selbst nicht nutzt, sondern gleichsam zwecklos und </p><p>unbebaut in Besitz hat, anderen untersagt, denen es nach dem Willen der </p><p>Natur ihren Lebensunterhalt liefern soll. Wenn aber einmal infolge eines </p><p>Ungl�cksfalles die Einwohnerzahl einiger ihrer St�dte so sehr sinken </p><p>sollte, da� sie aus anderen Teilen der Insel unter Wahrung der Gr��e </p><p>einer jeden Stadt nicht wieder erg�nzt werden kann -- wie es hei�t, ist </p><p>das seit Menschengedenken nur zweimal infolge einer heftig w�tenden </p><p>Seuche der Fall gewesen�--, so l��t man die B�rger aus der Kolonie </p><p>zur�ckkommen und f�llt mit ihnen die Einwohnerzahl der St�dte wieder </p><p>auf. Die Utopier sehen es n�mlich lieber, da� ihre Kolonien eingehen, </p><p>als da� die Einwohnerzahl einer der St�dte ihrer Insel zur�ckgeht. </p><p>Doch ich komme auf das Zusammenleben der B�rger zur�ck. Der �lteste ist, </p><p>wie gesagt, das Oberhaupt der Familie. Die Frauen dienen ihren M�nnern, </p><p>die Kinder ihren Eltern und so �berhaupt die J�ngeren den �lteren. </p><p>Jede Stadt zerf�llt in vier gleiche Teile. In der Mitte eines jeden </p><p>befindet sich ein Markt f�r alle Arten von Waren. Dorthin schafft man </p><p>die Arbeitserzeugnisse einer jeden Familie in bestimmte H�user, und die </p><p>einzelnen Warengattungen sind gesondert auf Speicher verteilt. Jeder </p><p>Familienvater verlangt dort, was er selbst und die Seinen brauchen, und </p><p>nimmt alles, was er haben will, mit, und zwar ohne Bezahlung und </p><p>�berhaupt ohne jede Gegenleistung. Warum sollte man ihm n�mlich auch </p><p>etwas verweigern? Alles ist ja im �berflu� vorhanden, und man braucht </p><p>nicht zu bef�rchten, da� jemand die Absicht hat, mehr zu verlangen, als </p><p>er braucht. Denn warum sollte man annehmen, es werde jemand �ber seinen </p><p>Bedarf hinaus fordern, wenn er sicher ist, da� es ihm niemals an etwas </p><p>fehlen wird? Werden doch bei jedem Lebewesen Habsucht und Raubgier durch </p><p>die Furcht vor Mangel hervorgerufen und beim Menschen allein au�erdem </p><p>noch durch Stolz, da er es sich zum Ruhme anrechnet, durch ein Prahlen </p><p>mit �berfl�ssigen Dingen die anderen zu �bertreffen; f�r diese Art </p><p>Fehler ist in den Einrichtungen der Utopier �berhaupt kein Platz. </p><p>Mit den erw�hnten M�rkten sind andere f�r Lebensmittel verbunden; auf </p><p>diese bringt man au�er Gem�se, Obst und Brot auch Fische und Fleisch. </p><p>Die Tiere sind au�erhalb der Stadt auf geeigneten Pl�tzen, wo man Blut </p><p>und Schmutz in flie�endem Wasser abwaschen kann, von Sklaven get�tet und </p><p>gereinigt worden. Die B�rger sollen sich n�mlich nicht an das Schlachten </p><p>von Tieren gew�hnen, weil man der Ansicht ist, die Gew�hnung an diese </p><p>T�tigkeit ert�te allm�hlich das Mitleid, den edelsten Zug unseres </p><p>Wesens. Auch soll nichts Schmutziges und Unreines in die Stadt gebracht </p><p>werden, dessen F�ulnis die Luft verpesten und eine Krankheit </p><p>einschleppen k�nnte. </p><p>Au�erdem stehen in jeder Stra�e, gleichweit voneinander entfernt, einige </p><p>ger�umige Hallen, von denen jede ihren eigenen Namen hat. Hier wohnen </p><p>die Syphogranten, und jeder dieser Hallen sind drei�ig Familien </p><p>zugeteilt, auf jeder Seite f�nfzehn, die dort ihre Mahlzeiten </p><p>einzunehmen haben. Die K�cheneink�ufer einer jeden Halle finden sich zu </p><p>einer bestimmten Stunde auf dem Markte ein, melden die Zahl der Esser </p><p>und fordern die Lebensmittel an. In erster Linie ber�cksichtigt man bei </p><p>dieser Verteilung die Kranken, die in den �ffentlichen Krankenh�usern </p><p>gepflegt werden. Im Stadtbezirk gibt es n�mlich vier, ein St�ck von der </p><p>Stadt entfernt; sie sind so ger�umig, da� man sie f�r ebenso viele </p><p>kleine St�dte halten k�nnte. Dadurch ist es m�glich, eine auch noch so</p><p>gro�e Zahl Kranker ohne Mangel an Raum und deshalb bequem unterzubringen </p><p>sowie die an ansteckenden Krankheiten Leidenden von den anderen recht </p><p>weit zu entfernen. Diese Krankenh�user sind so eingerichtet und mit </p><p>allem, was zur Gesundheitspflege geh�rt, so reichlich ausgestattet, die </p><p>Pflege ist so r�cksichtsvoll und gewissenhaft, und die erfahrensten </p><p>�rzte sind so unerm�dlich t�tig, da�, wenn auch niemand gegen seinen </p><p>Willen dort Aufnahme findet, doch wohl jeder in der Stadt im </p><p>Krankheitsfalle lieber im Krankenhaus als daheim liegt. </p><p>Nachdem der Eink�ufer f�r die Kranken die Lebensmittel nach �rztlicher </p><p>Vorschrift empfangen hat, verteilt man weiterhin das Beste gleichm��ig </p><p>auf die Hallen je nach deren Kopfzahl. Nur auf den B�rgermeister, den </p><p>Oberpriester und die Traniboren nimmt man besondere R�cksicht sowie auf </p><p>Gesandte und alle etwa anwesenden Ausl�nder. Doch sind letztere nur </p><p>vereinzelt und selten zu sehen; aber auch f�r sie stehen, wenn sie sich </p><p>im Lande aufhalten, bestimmte Wohnungen eingerichtet bereit. </p><p>In den erw�hnten Hallen findet sich die gesamte Syphograntie, durch den </p><p>Klang einer ehernen Trompete aufgefordert, zu den festgesetzten Stunden </p><p>des Mittags- und Abendessens ein, mit Ausnahme der in den Hospit�lern </p><p>oder daheim liegenden Kranken. Indes darf sich jedermann, wenn der </p><p>Bedarf der Hallen gedeckt ist, Lebensmittel vom Markt mit nach Hause </p><p>geben lassen; man wei� n�mlich, da� das niemand ohne Grund tun wird. </p><p>Denn wenn es auch keinem verwehrt ist, zu Hause zu essen, so tut das </p><p>doch niemand gern, da es f�r unanst�ndig gilt und t�richt w�re, sich </p><p>m�hsam ein schlechtes Mahl zuzubereiten, w�hrend in der Halle ganz in </p><p>der N�he ein reichliches und ausgezeichnetes Essen zu haben ist. In </p><p>einer solchen Halle verrichten Sklaven alle schmutzigeren und m�hsameren </p><p>Arbeiten, dagegen besorgen das Kochen und Zubereiten der Speisen sowie </p><p>die Vorbereitung des ganzen Mahles ausschlie�lich die Frauen der </p><p>einzelnen Familien, und zwar abwechselnd. </p><p>Je nach der Zahl der Esser speist man an drei oder mehr Tischen. Die </p><p>M�nner haben ihre Pl�tze an der Wand, die Frauen dagegen an der </p><p>Au�enseite der Tische. So k�nnen sie, wenn es ihnen pl�tzlich �bel wird, </p><p>was bei Schwangeren bisweilen vorkommt, ohne St�rung der Tischordnung </p><p>aufstehen und zu den stillenden M�ttern gehen. Diese sitzen n�mlich mit </p><p>ihren S�uglingen f�r sich in einem besonders zu diesem Zweck bestimmten </p><p>Speiseraum, wo es nie an Feuer und reinem Wasser fehlt; auch sind dort </p><p>Wiegen vorhanden, so da� die M�tter ihre Kleinen niederlegen oder, wenn </p><p>sie wollen, am Feuer aus den Windeln nehmen, sich frei bewegen lassen </p><p>und mit ihnen spielen k�nnen, damit sie wieder frisch und munter werden. </p><p>Jede Mutter stillt ihr Kind selber, soweit das nicht Tod oder Krankheit </p><p>unm�glich macht. Tritt dieser Fall ein, so besorgen die Frauen der </p><p>Syphogranten rasch eine Amme; und das ist bald geschehen; denn die </p><p>Frauen, die dazu imstande sind, bieten sich zu keiner Verrichtung lieber </p><p>an, da solches Mitleid allgemeines Lob findet und der S�ugling sp�ter in </p><p>der Amme seine Mutter sieht. </p><p>In der Ammenstube sitzen auch alle Kinder unter f�nf Jahren; die �brigen </p><p>Unm�ndigen -- dazu rechnet man die noch nicht Heiratsf�higen beiderlei </p><p>Geschlechts -- bedienen entweder bei Tisch oder, soweit sie noch zu jung </p><p>dazu sind, stehen sie doch dabei, und zwar in tiefstem Schweigen. Sie </p><p>essen, was ihnen die am Tische Sitzenden reichen, und haben keine </p><p>besondere Tischzeit. Am ersten Tisch in der Mitte sitzen der Syphogrant </p><p>und seine Frau. Das ist der oberste Platz, von dem aus man die gesamte </p><p>Gesellschaft �bersieht; denn dieser Tisch steht im obersten Teile des </p><p>Speisesaales quer. An den Syphogranten und seine Frau schlie�en sich </p><p>zwei der �ltesten an; an allen Tischen sitzt man n�mlich zu viert. Falls</p><p>aber ein Tempel in der betreffenden Syphograntie liegt, sitzen der </p><p>Priester und seine Frau so mit dem Syphogranten zusammen, da� sie den </p><p>Vorsitz f�hren. Auf beiden Seiten folgen dann J�ngere, danach wieder </p><p>Greise; auf diese Weise sitzen im ganzen Saale die Gleichaltrigen </p><p>nebeneinander und doch auch mit anderen Altersstufen zusammen. Wie es </p><p>hei�t, hat man diese Einrichtung deshalb getroffen, damit die W�rde der </p><p>Alten und die Ehrfurcht vor ihnen die J�ngeren von ungeh�riger </p><p>Ausgelassenheit in Rede und Benehmen abh�lt; denn nichts, was bei Tische </p><p>gesprochen oder getan wird, kann den Nachbarn ringsum entgehen. Die </p><p>einzelnen G�nge werden nicht vom ersten Platze aus der Reihe nach </p><p>gereicht, sondern die besten Gerichte werden immer zuerst allen �lteren </p><p>vorgesetzt, deren Pl�tze besonders kenntlich sind; danach bedient man </p><p>die �brigen ohne Unterschied. Jedoch geben die Greise von ihren </p><p>Leckerbissen ganz nach Belieben den Umsitzenden ab; um sie n�mlich im </p><p>ganzen Saale in gen�gender Menge zu verteilen, sind es nicht genug. Auf </p><p>diese Weise bleibt den �lteren die ihnen zukommende Ehre gewahrt, und </p><p>trotzdem wird der Allgemeinheit die gleiche Bevorzugung zuteil. </p><p>Zu Beginn einer jeden Mittags- und Abendmahlzeit wird ein Text </p><p>moralischen Inhalts vorgelesen, der jedoch nur kurz ist, damit man der </p><p>Sache nicht �berdr�ssig wird. Im Anschlu� daran f�hren die �lteren </p><p>ehrbare Gespr�che, die weder trocken noch ohne Witz sind. Indessen </p><p>halten sie nicht etwa w�hrend des ganzen Essens lange Reden; sie h�ren </p><p>vielmehr auch den jungen Leuten gern zu. Ja, sie veranlassen sie </p><p>absichtlich zum Reden, um von dem Charakter und Geist eines jeden einen </p><p>Begriff zu bekommen, wenn er sich in der bei einem Mahle herrschenden </p><p>Ungebundenheit offenbart. Die Mittagsmahlzeiten sind ziemlich schlicht, </p><p>die Abendmahlzeiten dagegen reichlicher; denn auf jene folgt Arbeit, auf </p><p>diese Schlaf und n�chtliche Ruhe, und diese hilft nach Ansicht der </p><p>Utopier besser verdauen. Bei keinem Abendessen fehlt es an Musik, und </p><p>bei jedem Nachtisch gibt es allerlei Leckereien. Auch verbrennt man </p><p>R�ucherwerk, verspritzt wohlriechendes Salb�l und bietet alles auf, um </p><p>die Tischgenossen zu erheitern. Die Utopier neigen n�mlich viel zu sehr </p><p>zu solcher Fr�hlichkeit, um ein Vergn�gen, das keinen Schaden anrichtet, </p><p>f�r verboten zu halten. </p><p>Derart also ist das gesellige Leben in der Stadt; auf dem Lande dagegen, </p><p>wo man weiter auseinander wohnt, i�t jeder f�r sich zu Hause. Dort fehlt </p><p>es n�mlich keiner Familie an irgend etwas zum Leben; denn die Leute auf </p><p>dem Lande sind es ja, die alles das liefern, wovon die St�dter leben. </p><p>Die Reisen der Utopier </p><p>Wer das Verlangen haben sollte, seine Freunde in einer anderen Stadt zu </p><p>besuchen oder sich auch nur den Ort selbst anzusehen, erh�lt von seinem </p><p>Syphogranten und Traniboren mit Leichtigkeit die Erlaubnis dazu, wenn er </p><p>irgendwie abk�mmlich ist. Man schickt dann eine gewisse Anzahl Urlauber </p><p>zusammen ab und gibt ihnen ein Schreiben des B�rgermeisters mit, in dem </p><p>die Reisegenehmigung best�tigt und der Tag der R�ckkehr vorgeschrieben </p><p>ist. Die Reisenden bekommen einen Wagen mit einem staatlichen Sklaven </p><p>gestellt, der das Ochsengespann f�hren und besorgen mu�; wenn sie aber </p><p>nicht gerade Frauen bei sich haben, weisen sie den Wagen als l�stig und </p><p>hinderlich zur�ck. Obgleich sie auf der ganzen Reise nichts mit sich </p><p>f�hren, fehlt es ihnen doch an nichts; sie sind ja �berall zu Hause. </p><p>Sollten sie sich irgendwo l�nger als einen Tag aufhalten, so �bt jeder </p><p>daselbst sein Gewerbe aus und wird von seinen Handwerksgenossen aufs </p><p>freundlichste behandelt. </p><p>Wenn sich aber jemand au�erhalb seines Wohnbezirks eigenm�chtig </p><p>herumtreiben und ohne amtlichen Urlaubsschein aufgegriffen werden </p><p>sollte, so betrachtet man ihn als Ausrei�er, bringt ihn mit Schimpf und </p><p>Schande in die Stadt zur�ck und z�chtigt ihn streng; im </p><p>Wiederholungsfalle b��t er mit dem Verlust seiner Freiheit. Wenn aber </p><p>jemanden die Lust anwandeln sollte, auf seinen heimatlichen Fluren </p><p>spazierenzugehen, so hindert ihn niemand daran, vorausgesetzt, da� er </p><p>die Erlaubnis seines Hausvaters und die Einwilligung seiner Frau hat. </p><p>Wohin er aber auch aufs Land kommt, nirgends gibt man ihm etwas zu </p><p>essen, ehe er nicht das dort vor dem Mittags- oder Abendessen �bliche </p><p>Arbeitspensum erledigt hat; unter dieser Bedingung kann er ganz nach </p><p>Belieben innerhalb des Gebietes seiner Stadt spazierengehen. Wird er </p><p>sich doch auf diese Weise der Stadt ebenso n�tzlich machen, als wenn er </p><p>sich in ihr selber aufhielte. </p><p>Ihr seht schon, in Utopien gibt es nirgends eine M�glichkeit zum </p><p>M��iggang oder einen Vorwand zur Tr�gheit. Keine Weinschenken, keine </p><p>Bierh�user, nirgends ein Bordell, keine Gelegenheit zur Verf�hrung, </p><p>keine Schlupfwinkel, keine St�tten der Liederlichkeit; jeder ist </p><p>vielmehr den Blicken der Allgemeinheit ausgesetzt, die ihn entweder zur </p><p>gewohnten Arbeit zwingt oder ihm nur ein ehrbares Vergn�gen gestattet. </p><p>Diese Lebensf�hrung des Volkes hat notwendig einen �berflu� an jeglichem </p><p>Lebensbedarf zur Folge, und da alle gleichm��ig daran teilhaben, ist es </p><p>ganz nat�rlich, da� es Arme oder gar Bettler �berhaupt nicht geben kann. </p><p>Im Senat von Mentiranum, wo sich, wie erw�hnt, allj�hrlich drei </p><p>Abgeordnete aus jeder Stadt einfinden, stellt man zun�chst fest, wovon </p><p>es in den einzelnen Bezirken einen �berschu� gibt und worin irgendwo der </p><p>Ertrag zu gering gewesen ist. Dann gleicht man alsbald den Mangel der </p><p>einen Bezirke durch den �berflu� der anderen aus, und zwar geschieht </p><p>das unentgeltlich, ohne da� die Geber von den Empf�ngern eine </p><p>Entsch�digung erhalten. Daf�r aber, da� eine Stadt irgendeiner anderen </p><p>aus ihren Best�nden ohne Gegenforderung liefert, erh�lt sie auch wieder, </p><p>was sie braucht, von einer Stadt, der sie nichts gegeben hat. So bildet </p><p>die ganze Insel gleichsam eine einzige Familie. </p><p>Nachdem aber die Utopier sich selbst zur Gen�ge mit Vorr�ten versorgt </p><p>haben, was nach ihrer Ansicht erst dann der Fall ist, wenn sie wegen der </p><p>Unsicherheit des Ertrags im darauffolgenden Jahre f�r einen Zeitraum von </p><p>zwei Jahren vorgesorgt haben, f�hren sie aus dem �berschu� eine gro�e </p><p>Menge Getreide, Honig, Wolle, Leinen, Holz, Scharlach- und Purpurfarben, </p><p>Felle, Wachs, Seife, Leder sowie au�erdem Vieh in andere L�nder aus. Von </p><p>dem allen schenken sie ein Siebentel den Armen des betreffenden Landes, </p><p>den Rest aber verkaufen sie zu m��igem Preise. Dieser Handel bringt </p><p>ihnen nicht nur diejenigen Waren ins Land, an denen es ihnen fehlt -- </p><p>das ist aber fast nichts weiter als Eisen�--, sondern au�erdem eine </p><p>gro�e Menge Silber und Gold. Weil sie das schon lange so halten, haben </p><p>sie an diesen Metallen �berall einen unglaublich gro�en �berflu�. Daher </p><p>legen sie jetzt auch nicht sonderlich viel Gewicht darauf, ob sie gegen </p><p>bar oder auf Kredit verkaufen und den bei weitem gr��ten Teil ihrer </p><p>Forderungen als Au�enst�nde haben. Doch lehnen sie bei der Ausstellung </p><p>von Schuldscheinen die B�rgschaft von Privatpersonen regelm��ig ab und </p><p>verlangen immer auf Grund formell ausgestellter Scheine die B�rgschaft </p><p>der Stadt. Diese zieht dann am Zahltage den Betrag von den </p><p>Privatschuldnern ein, legt ihn in die Stadtkasse und hat bis zu seiner </p><p>Anforderung durch die Utopier den Zinsgenu�. Diese verlangen aber </p><p>niemals den gr��ten Teil zur�ck; nach ihrer Ansicht ist es n�mlich eine </p><p>Ungerechtigkeit, anderen etwas wegzunehmen, was f�r sie von Nutzen ist, </p><p>ihnen selbst aber keinen Nutzen bringt. Wenn sie dagegen</p><p>erforderlichenfalls einen Teil des betreffenden Geldes einem anderen </p><p>Volke leihen wollen, so verlangen sie es dann erst zur�ck oder auch, </p><p>wenn sie selbst Krieg f�hren m�ssen. F�r diesen einen Zweck n�mlich </p><p>heben sie jenen gesamten Schatz, den sie im Lande haben, auf, um an ihm </p><p>in �u�erster oder pl�tzlicher Gefahr einen R�ckhalt zu haben, vor allem </p><p>aber, um damit f�r unm��ig hohen Sold ausl�ndische Soldaten anzuwerben; </p><p>denn diese setzen sie lieber der Gefahr aus als ihre eigenen B�rger. </p><p>Au�erdem wissen sie, da� in der Regel die Feinde selber mit viel Geld </p><p>sich kaufen und gegeneinander hetzen lassen, sei es durch Verrat oder </p><p>auch durch Entzweiung. Aus diesem Grunde sorgen die Utopier f�r einen </p><p>Staatsschatz von unerme�lichem Werte. Er ist aber in ihren Augen kein </p><p>eigentlicher Schatz; sie halten es damit vielmehr so, da� ich mich in </p><p>der Tat sch�me, es zu erz�hlen, weil ich f�rchten mu�, man wird meinen </p><p>Worten nicht glauben. Und meine Bef�rchtung ist um so berechtigter, je </p><p>mehr ich mir bewu�t bin, wie schwer man mich selbst dazu h�tte bringen </p><p>k�nnen, es einem anderen zu glauben, wenn ich es nicht pers�nlich erlebt </p><p>h�tte. Es kann ja gar nicht anders sein, als da� etwas um so weniger </p><p>Glauben findet, je mehr es von den Br�uchen der Zuh�rer abweicht. Da </p><p>freilich auch die �brigen Einrichtungen der Utopier so wesentlich </p><p>anders als die unsrigen sind, wird sich ein kluger Beurteiler der Dinge </p><p>vielleicht weniger wundern, wenn sie auch Gold und Silber auf eine Weise </p><p>benutzen, die mehr ihrem eigenen als unserem Brauche entspricht. Da die </p><p>Utopier n�mlich selber kein Geld verwenden, sondern es nur f�r einen </p><p>Fall aufsparen, der ebensogut eintreten wie nicht eintreten kann, so </p><p>sch�tzt niemand von ihnen Gold und Silber, woraus das Geld gemacht wird, </p><p>h�her, als es ihrem nat�rlichen Werte angemessen ist. Wer sieht da </p><p>nicht, wie weit dort Gold und Silber unter dem Eisen stehen! Und in der </p><p>Tat ist Eisen f�r die Menschheit ebenso lebensnotwendig wie Wasser und </p><p>Feuer, w�hrend weder Gold noch Silber von Natur einen Vorzug besitzt, </p><p>den wir nicht mit Leichtigkeit entbehren k�nnten; nur halten es die </p><p>Menschen in ihrer Torheit wegen seines seltenen Vorkommens f�r so </p><p>besonders wertvoll. Und dabei hat doch im Gegenteil die Natur, wie eine </p><p>�beraus g�tige Mutter, uns gerade ihre besten Gaben offen und frei vor </p><p>Augen gestellt, wie die Luft, das Wasser und die Erde selbst, das </p><p>Nichtige und Unn�tze dagegen sehr weit entr�ckt. W�rde nun Gold und </p><p>Silber bei den Utopiern in irgendeinem Turme versteckt, so k�nnte der </p><p>t�richte Argwohn der gro�en Masse den B�rgermeister und den Senat </p><p>verd�chtigen, sie wollten das Volk auf hinterlistige Weise betr�gen, um </p><p>selber irgendwelchen Vorteil daraus zu ziehen. Wenn sie ferner Schalen </p><p>und andere derartige Schmiedearbeiten aus Gold und Silber herstellen </p><p>lie�en, so k�nnte einmal der Fall eintreten, da� man sie wieder </p><p>einschmelzen und zur Soldzahlung an die Truppen verwenden m��te, und </p><p>nat�rlich w�rden dann die Besitzer der Gegenst�nde, das sehen sie ein, </p><p>sich nur ungern wieder entrei�en lassen, woran sie allm�hlich Freude </p><p>gefunden haben. Um es zu alledem nicht kommen zu lassen, haben sich die </p><p>Utopier ein Mittel ausgedacht, das mit ihren �brigen Einrichtungen </p><p>ebenso �bereinstimmt, wie es von den unsrigen stark abweicht, da ja bei </p><p>uns Gold so hoch gesch�tzt und so sorgf�ltig aufbewahrt wird, und das </p><p>deshalb nur denen, die es aus Erfahrung kennen, glaubhaft erscheint. </p><p>W�hrend sie n�mlich zum Essen und Trinken nur Gef��e aus Ton und Glas </p><p>benutzen, die zwar sehr h�bsch aussehen, aber trotzdem billig sind, </p><p>fertigen sie aus Gold und Silber nicht blo� f�r die Gemeinschaftshallen, </p><p>sondern auch f�r die Privath�user allenthalben Nachtgeschirre und </p><p>sonstige zu ganz gew�hnlichem Gebrauch bestimmte Gef��e an. Au�erdem </p><p>stellen sie aus denselben Metallen Ketten und starke Fu�fesseln zur </p><p>Bestrafung der Sklaven her, und schlie�lich h�ngen von den Ohren derer, </p><p>die durch irgendein Verbrechen ihre Ehre verloren haben, goldene Ringe </p><p>herab; man steckt ihnen goldene Ringe an die Finger, h�ngt ihnen eine </p><p>goldene Halskette um und legt einen goldenen Reif um ihren Kopf. So</p><p>sorgen die Utopier mit allen Mitteln daf�r, da� Gold und Silber bei </p><p>ihnen in Verruf kommt, und so erkl�rt es sich auch, da� in Utopien bei </p><p>einer sich etwa n�tig machenden Ablieferung alles Goldes und Silbers, </p><p>dessen gewaltsame Wegnahme den anderen V�lkern fast ebensolche Schmerzen </p><p>bereitet, als wenn man ihnen die Eingeweide auseinanderrisse, niemand </p><p>glauben w�rde, auch nur einen Heller einzub��en. </p><p>Au�erdem sammeln die Utopier an den K�sten Perlen, in gewissen Felsen </p><p>sogar Diamanten und Karfunkel. Doch suchen sie nicht danach, sondern </p><p>nur, was sie zuf�llig finden, schleifen sie. Damit putzen sie ihre </p><p>kleinen Kinder. In ihren ersten Lebensjahren prahlen diese gern mit </p><p>solchem Schmuck und sind stolz darauf; sobald sie aber ein wenig �lter </p><p>werden und merken, da� sich nur Kinder mit derartigem Tand abgeben, </p><p>legen sie diesen Schmuck ab, und zwar ohne besondere Ermahnung von </p><p>seiten ihrer Eltern, sondern einfach, weil sie sich seiner sch�men, </p><p>genau so wie bei uns die Kinder, wenn sie erst gr��er werden, von ihren </p><p>N�ssen, Kn�pfen und Puppen nichts mehr wissen wollen. </p><p>Wie stark aber diese Lebensgewohnheiten der Utopier, die von denen der </p><p>�brigen V�lker so sehr abweichen, ihr ganzes Empfinden ver�ndern, ist </p><p>mir niemals so klar zum Bewu�tsein gekommen wie bei einer Gesandtschaft </p><p>der Anemolier. Diese kam nach Amaurotum, als ich gerade dort war, und da </p><p>wichtige Fragen zur Verhandlung standen, waren schon vor ihr jene fr�her </p><p>erw�hnten drei Abgeordneten aus jeder Stadt eingetroffen. Nun waren </p><p>allen Gesandten der Nachbarv�lker, die schon fr�her dorthin gekommen </p><p>waren, die Sitten der Utopier bekannt. Sie wu�ten, da� prunkvolle </p><p>Kleidung dort durchaus nicht angesehen war, da� man Seide geradezu </p><p>verachtete und da� Goldschmuck sogar in �blen Ruf brachte. Deshalb </p><p>hatten sie sich daran gew�hnt, in m�glichst bescheidener Kleidung zu </p><p>erscheinen. Die Anemolier aber wohnten weiter entfernt von den Utopiern </p><p>und hatten deshalb weniger Verkehr mit ihnen unterhalten. Als sie nun </p><p>h�rten, die Utopier tr�gen alle die gleiche grobe Tracht, waren sie </p><p>�berzeugt, sie trieben deshalb keinen Aufwand, weil es ihnen an den </p><p>n�tigen Mitteln dazu fehle, und beschlossen daher, mehr eitel als klug, </p><p>pr�chtig wie G�tter herausgeputzt aufzutreten und die Augen der </p><p>armseligen Utopier durch den Glanz ihrer prunkvollen Kleidung zu </p><p>blenden. So zogen denn die drei Gesandten an der Spitze eines Gefolges </p><p>von dreihundert Mann in die Stadt ein, alle in bunter, die meisten in </p><p>seidener Kleidung, die Gesandten selbst -- sie geh�rten n�mlich daheim </p><p>zum Adel -- in golddurchwirkten Gew�ndern, mit gro�en Halsketten und </p><p>Ohrringen aus Gold, an den Fingern goldene Ringe, die Filzkappen mit </p><p>B�ndern geschm�ckt, die von Perlen und Edelsteinen funkelten, kurz, mit </p><p>all den Dingen geputzt, die bei den Utopiern Strafen f�r Sklaven oder </p><p>Schandmale Ehrloser oder Spielzeug kleiner Kinder sind. Und so lohnte es </p><p>sich der M�he zu sehen, wie den Anemoliern der Kamm schwoll, als sie </p><p>ihren Prunk mit der Kleidung der Utopier verglichen; die Bev�lkerung war </p><p>n�mlich in Menge auf die Stra�en gestr�mt. Anderseits aber machte es </p><p>nicht weniger Spa� zu beobachten, wie gr�ndlich sie sich in ihrer </p><p>Hoffnung und Erwartung get�uscht sahen und wie wenig sie den Eindruck </p><p>machten, mit dem sie gerechnet hatten. Denn in den Augen aller Utopier, </p><p>nur einige ganz wenige ausgenommen, die bei irgendeiner passenden </p><p>Gelegenheit ins Ausland gekommen waren, war jener ganze gl�nzende </p><p>Aufwand eine Schmach. Sie gr��ten gerade die Niedrigsten an Stelle ihrer </p><p>Herren mit Ehrerbietung, die Gesandten selbst aber hielten sie wegen </p><p>ihrer goldenen Ketten f�r Sklaven und lie�en sie vor�bergehen, ohne </p><p>ihnen �berhaupt eine Ehrenbezeigung zu erweisen. Ja, auch die Knaben </p><p>h�ttest du sehen sollen, die ihre Edelsteine und Perlen schon l�ngst </p><p>weggeworfen hatten. Beim Anblick der Edelsteine an den Filzkappen der </p><p>Gesandten riefen und stie�en sie ihre M�tter an und sagten: �Sieh doch,</p><p>Mutter, was f�r ein gro�er Schelm da noch die Perlen und Edelsteinchen </p><p>tr�gt, als wenn er ein kleines Kind w�re!� Und die Mutter erwiderte </p><p>gleichfalls ganz ernsthaft: �Sei still, mein Junge! Das wird einer von </p><p>den Narren der Gesandten sein.� Andere wieder bem�ngelten die goldenen </p><p>Ketten: sie seien zu nichts zu brauchen, weil sie so d�nn seien, da� der </p><p>Sklave sie mit Leichtigkeit zerbrechen k�nne; anderseits wieder seien </p><p>sie so locker, da� er sie, wenn er Lust habe, absch�tteln und </p><p>ungehindert und frei ausrei�en k�nne, wohin er wolle. </p><p>Die Gesandten hatten sich erst ein paar Tage in Amaurotum aufgehalten </p><p>und schon eine Unmenge Gold in niedrigster Verwendung gesehen; auch </p><p>hatten sie gemerkt, da� das Gold hier ebenso gering wie bei ihnen daheim </p><p>hochgesch�tzt wurde; au�erdem sahen sie in den Ketten und Fu�fesseln </p><p>eines einzigen Sklaven, der fl�chtig geworden war, mehr Gold und Silber </p><p>zusammen verarbeitet, als die gesamte Ausstattung der drei Gesandten </p><p>wert war. Da lie�en sie die Fl�gel h�ngen und legten besch�mt jenen </p><p>ganzen Aufputz ab, mit dem sie sich in so anma�ender Weise gebr�stet </p><p>hatten, vor allem aber, nachdem sie durch vertrautere Unterhaltung mit </p><p>den Utopiern ihre Sitten und Anschauungen kennengelernt hatten. Sind </p><p>doch diese ganz verwundert dar�ber, wie einem Menschen das unsichere </p><p>Gefunkel eines d�rftigen Juwels oder Edelsteinchens �berhaupt Freude </p><p>machen kann, w�hrend er irgendeinen Stern und schlie�lich die Sonne </p><p>selbst anschauen darf, und wie jemand so albern sein kann, da� er sich </p><p>selber wegen eines Gewebes aus feinerer Wolle vornehmer d�nkt, wenn </p><p>diese Wolle selbst, mag der Faden auch noch so fein sein, fr�her einmal </p><p>auf dem R�cken eines Schafes gesessen hat und inzwischen doch auch </p><p>nichts anderes als Wolle gewesen ist. Ebenso wundern sich die Utopier </p><p>dar�ber, da� das Gold, das seiner Natur nach so unn�tz ist, jetzt </p><p>�berall in der Welt so hoch gesch�tzt wird, da� der Mensch selbst, durch </p><p>den und vor allem zu dessen Nutzen es diesen Wert erlangt hat, viel </p><p>weniger gilt als das Gold selber, und zwar so viel weniger, da� </p><p>irgendein D�mlack, geistlos wie ein Holzklotz und ebenso schlecht wie </p><p>dumm, trotzdem eine Menge kluger und braver Diener hat, allein deshalb, </p><p>weil er zuf�llig einen gro�en Haufen Goldst�cke sein eigen nennt. Wenn </p><p>nun irgendeine F�gung des Geschicks oder ein Trick der Gesetze, der, </p><p>ebenso wie das Schicksal, das Unterste zu oberst kehrt, dieses Gold dem </p><p>Herrn des Hauses nimmt und es dem allerschlimmsten Taugenichts seines </p><p>Gesindes zukommen l��t, so w�rde jener ohne Zweifel bald darauf wie ein </p><p>Anh�ngsel und eine Zugabe seiner M�nzen unter die Dienerschaft seines </p><p>ehemaligen Dieners geraten. Und noch mehr ist man erstaunt, ja geradezu </p><p>emp�rt �ber das unsinnige Gebaren der Leute, die jene Reichen, denen sie </p><p>nichts schuldig und denen sie nicht verpflichtet sind, aus keinem </p><p>anderen Grunde, als weil sie reich sind, wie G�tter anbeten, und zwar </p><p>auch dann, wenn sie ihren schmutzigen Geiz zu genau kennen, um nicht mit </p><p>t�dlicher Sicherheit zu wissen, da� sie bei deren Lebzeiten von dem </p><p>gro�en Geldhaufen auch nicht einen roten Heller bekommen. </p><p>Diese und andere derartige Ansichten der Utopier sind das Ergebnis teils </p><p>ihrer Erziehung in einem Staate, dessen Einrichtungen von den Torheiten </p><p>der geschilderten Art weit entfernt sind, teils ihrer Besch�ftigung mit </p><p>Wissenschaft und Literatur. Allerdings sind in jeder Stadt nur wenige </p><p>von den anderen Arbeiten befreit, um sich ausschlie�lich der Ausbildung </p><p>ihres Geistes zu widmen, n�mlich diejenigen, bei denen man von Kind auf </p><p>hervorragende Anlagen, ausgezeichnete Begabung und Neigung zu </p><p>wissenschaftlicher Besch�ftigung beobachtet hat. Trotzdem aber genie�en </p><p>alle Kinder Unterricht, und ein guter Teil des Volkes, M�nner und </p><p>Frauen, besch�ftigt sich das ganze Leben hindurch in den erw�hnten </p><p>arbeitsfreien Stunden mit den Wissenschaften. </p><p>Der Unterricht wird in der Landessprache erteilt; sie verf�gt n�mlich </p><p>�ber einen reichen Wortschatz, zeichnet sich durch Wohllaut aus und ist </p><p>wie keine andere zur Wiedergabe von Gedanken geeignet. In ann�hernd </p><p>derselben Art, jedoch �berall auf verschiedene Weise etwas zu ihrem </p><p>Nachteil ver�ndert, ist sie �ber einen gro�en Strich jenes Erdteils </p><p>verbreitet. </p><p>Von allen unseren Philosophen, deren Namen in dieser uns bekannten Welt </p><p>ber�hmt sind, war den Utopiern vor unserer Ankunft auch nicht ein </p><p>einziger, nicht einmal ger�chtweise, bekannt geworden; und doch haben </p><p>sie in Musik, Dialektik, Arithmetik und Geometrie etwa dieselben </p><p>Entdeckungen gemacht wie unsere alten Meister. Wenn sie aber auch die </p><p>Alten beinahe in allem erreicht haben, so sind sie allerdings hinter den </p><p>Erfindungen der modernen Dialektiker weit zur�ckgeblieben; sie haben </p><p>n�mlich auch nicht eine einzige der in der �Kleinen Logik� so </p><p>scharfsinnig ausgedachten Regeln �ber Restriktion, Amplifikation und </p><p>Supposition erfunden, die hierzulande allenthalben schon die Kinder </p><p>auswendig lernen. Wie sie ferner keineswegs den �zweiten Intentionen� </p><p>nachzuforschen vermochten, so war auch nicht einer von ihnen imstande, </p><p>den sogenannten �Menschen �berhaupt� zu sehen, der doch, wie ihr wi�t, </p><p>ein wahrer Kolo� und gr��er als jeder Riese ist und auf den wir damals </p><p>auch noch mit den Fingern gezeigt haben. </p><p>Dagegen kennen sie ganz genau den Lauf der Gestirne und die Bewegung der </p><p>Himmelskreise. Ja, sie haben sich auch Instrumente von verschiedener </p><p>Gestalt mit Kunst und Geschick ausgedacht, mit deren Hilfe sie die </p><p>Bewegungen und Stellungen der Sonne, des Mondes und ebenso der �brigen </p><p>bei ihnen sichtbaren Gestirne aufs genaueste erfa�t haben. Aber von </p><p>Gunst und Mi�gunst der Planeten und von jenem ganzen Schwindel der </p><p>Prophezeiung aus den Sternen lassen sie sich nicht einmal etwas tr�umen. </p><p>Regen, Wind und die �brigen Wetterver�nderungen sagen sie aus gewissen </p><p>Anzeichen voraus, die sie aus langer Erfahrung kennen. �ber die Ursachen </p><p>all dieser Erscheinungen aber, �ber Ebbe und Flut sowie �ber den </p><p>Salzgehalt des Meeres und schlie�lich �ber den Ursprung und die Natur </p><p>des Himmels und der Erde lehren sie zum Teil dasselbe wie unsere alten </p><p>Philosophen. Wie diese aber schon untereinander verschiedener Meinung </p><p>sind, so stimmen auch die Utopier mit ihren neuen Erkl�rungen f�r die </p><p>Naturerscheinungen mit ihnen allen zum Teil nicht �berein, sind aber </p><p>auch untereinander nicht in jeder Beziehung derselben Ansicht. </p><p>In der Moralphilosophie behandeln die Utopier dieselben Fragen wie wir. </p><p>Sie stellen Er�rterungen an �ber die G�ter des Geistes und des K�rpers </p><p>sowie �ber die �u�eren G�ter, ferner ob diese alle oder nur die Gaben </p><p>des Geistes als G�ter bezeichnet werden d�rfen; auch untersuchen sie das </p><p>Wesen der Tugend und der Lust. Aber die erste und wichtigste aller </p><p>Streitfragen ist die, worin wohl die Gl�ckseligkeit des Menschen </p><p>besteht, ob in _einem_ Dinge oder in mehreren. In diesem Punkte aber </p><p>neigen sie, wie es scheint, mehr als billig zu der Ansicht derer, die </p><p>f�r das Vergn�gen eintreten, worin sie entweder das menschliche Gl�ck </p><p>�berhaupt oder doch wenigstens seinen wesentlichsten Bestandteil </p><p>erblicken. Und wor�ber man sich noch mehr wundern mu�, sie st�tzen ihre </p><p>so sinnenfreudige Ansicht auch mit Beweisgr�nden, die sie ihrer Religion </p><p>entnehmen, einer ernsten und strengen, ja fast d�steren und harten </p><p>Lehre. Wenn sie n�mlich �ber die Gl�ckseligkeit verhandeln, so verbinden </p><p>sie stets gewisse Grunds�tze ihrer Religion mit der Philosophie, die mit </p><p>Vernunftgr�nden arbeitet; denn ohne diese Grunds�tze ist die Vernunft </p><p>nach Ansicht der Utopier zu ungen�gend und zu schwach, um f�r sich </p><p>allein die wahre Gl�ckseligkeit zu erforschen. </p><p>Diese Grunds�tze sind folgende: Die Seele ist unsterblich und durch die </p><p>G�te Gottes zur Gl�ckseligkeit geschaffen; f�r unsere Tugenden und </p><p>guten Werke erwarten uns nach diesem Leben Belohnungen, f�r unsere </p><p>Missetaten aber Strafen. Diese Anschauungen sind zwar religi�ser Natur, </p><p>aber nach Ansicht der Utopier f�hrt schon die Vernunft dazu, an sie zu </p><p>glauben und sie zu billigen. Nach Beseitigung dieser Grunds�tze, so </p><p>erkl�ren sie ohne jedes Bedenken, wird niemand so t�richt sein zu </p><p>meinen, er d�rfe dem Vergn�gen nicht auf jede Weise, auf rechte und </p><p>unrechte, nachjagen. Nur m�sse man sich, so erkl�ren sie weiter, davor </p><p>h�ten, ein gr��eres Vergn�gen durch ein kleineres beeintr�chtigen zu </p><p>lassen oder einem Vergn�gen mit schmerzhaften R�ckwirkungen nachzugehen. </p><p>Denn den dornenvollen und beschwerlichen Pfad der Tugend zu wandeln und </p><p>dabei nicht blo� auf des Lebens Annehmlichkeiten zu verzichten, sondern </p><p>auch den Schmerz freiwillig zu ertragen, und zwar ohne Aussicht auf </p><p>irgendwelchen Gewinn -- was k�nnte n�mlich wohl auch der Gewinn sein, </p><p>wenn man nach dem Tode nichts erreichen soll, nachdem man dieses ganze </p><p>Leben freudlos, also j�mmerlich, zugebracht hat? -- das ist in den Augen </p><p>der Utopier das Sinnloseste, was es geben kann. Nun liegt aber nach </p><p>ihrer Meinung das Gl�ck nicht in jeder Art von Vergn�gen, sondern nur in </p><p>einem rechtschaffenen und ehrbaren; zu diesem n�mlich, als zu dem </p><p>h�chsten Gut, zieht, so sagen sie, die Tugend selbst unsere Natur hin, </p><p>w�hrend nach Ansicht der Gegenpartei einzig und allein die Tugend unser </p><p>Gl�ck bedingt. Die Tugend besteht n�mlich, wie die Utopier meinen, in </p><p>einem naturgem��en Leben, sofern uns Gott dazu geschaffen hat; </p><p>naturgem�� aber lebt der, der in allem, was er begehrt und meidet, den </p><p>Geboten der Vernunft gehorcht. Die Vernunft entfacht ferner im Menschen </p><p>vor allem anderen die ehrfurchtsvolle Liebe zur g�ttlichen Majest�t, und </p><p>dieser verdanken wir es ja, da� wir sind und an der Gl�ckseligkeit </p><p>teilnehmen d�rfen. Sodann mahnt uns die Tugend und regt uns dazu an, ein </p><p>m�glichst sorgenfreies und frohes Leben zu f�hren und allen unseren </p><p>Mitmenschen, entsprechend unserer nat�rlichen Gemeinschaft mit ihnen, </p><p>zur Erreichung des gleichen Zieles zu verhelfen. Denn noch nie ist </p><p>jemand ein so finsterer und strenger Anh�nger der Tugend und </p><p>entschiedener Feind des Vergn�gens gewesen, da� er von dir </p><p>Anstrengungen, Nachtwachen und Kasteiungen verlangte, ohne nicht </p><p>gleichzeitig dir aufzugeben, die Not und das Ungemach anderer nach </p><p>Kr�ften zu lindern, und ohne es nicht im Namen der Menschlichkeit f�r </p><p>lobenswert zu halten, da� ein Mensch dem anderen Heil und Trost spendet. </p><p>Wenn nun die h�chste Menschlichkeit darin besteht -- und keine Tugend </p><p>ist dem Menschen eigent�mlicher�--, den Kummer der Mitmenschen zu </p><p>lindern, ihre Traurigkeit zu beheben und in ihr Leben wieder die Freude, </p><p>das hei�t das Vergn�gen, zu bringen, wie sollte da nicht die Natur einen </p><p>jeden anspornen, die gleiche Wohltat auch sich selber zuteil werden zu </p><p>lassen? Denn entweder ist ein angenehmes, das hei�t dem Vergn�gen </p><p>gewidmetes Leben verwerflich, dann darfst du nicht blo� niemandem zu </p><p>einem Vergn�gen verhelfen, sondern mu�t es sogar von allen nach </p><p>M�glichkeit fernhalten, da es ihnen ja sch�dlich ist und den Tod bringt. </p><p>Oder aber, wenn du anderen ein Vergn�gen als etwas Gutes nicht blo� </p><p>verschaffen darfst, sondern sogar verschaffen sollst, warum dann nicht </p><p>vor allem dir selbst, dem du doch nicht weniger als anderen gewogen sein </p><p>solltest? Denn wenn die Natur dich zur G�te gegen andere mahnt, verlangt </p><p>sie doch nicht gleichzeitig von dir schonungslose Strenge gegen dich </p><p>selbst. </p><p>Ein angenehmes Leben also, das hei�t eben das Vergn�gen, sagen die </p><p>Utopier, stellt uns die Natur selbst gleichsam als Ziel aller unserer </p><p>Handlungen hin, und ein Leben nach ihrer Vorschrift ist in ihren Augen </p><p>Tugend. Die Natur aber ruft auch die Menschen auf, sich gegenseitig zu </p><p>einem Leben in gr��ter Fr�hlichkeit zu verhelfen. Und das tut sie</p><p>sicherlich mit Fug und Recht; denn keiner ist so erhaben �ber das </p><p>allgemeine Menschenschicksal, da� die Natur f�r ihn allein sorgen m��te, </p><p>sie, die alle, die sie durch die Gleichheit der Gestalt zu einer </p><p>Gemeinschaft zusammenfa�t, in gleicher Weise hegt und pflegt. Und eben </p><p>darum hei�t sie dich auch immer wieder darauf achten, auf deinen eigenen </p><p>Vorteil nicht so bedacht zu sein, da� du anderen dabei schadest. </p><p>Deshalb d�rfen auch nach Ansicht der Utopier nicht blo� die Vertr�ge </p><p>zwischen Privatpersonen nicht verletzt werden, sondern auch die </p><p>�ffentlichen Bestimmungen �ber die Teilung der Lebensg�ter, das hei�t </p><p>der materiellen Grundlage des Vergn�gens, Bestimmungen, die entweder ein </p><p>guter F�rst auf gesetzlichem Wege erlassen oder die ein Volk auf Grund </p><p>einer allgemeinen �bereinkunft getroffen hat, ohne durch Tyrannei in </p><p>seiner Willens�u�erung beschr�nkt oder durch Betrug umgarnt zu sein. </p><p>Ohne Verletzung dieser Gesetze f�r dein pers�nliches Wohlergehen zu </p><p>sorgen, erfordert die Klugheit, au�erdem das allgemeine Wohl im Auge zu </p><p>haben, das Pflichtgef�hl; aber darauf auszugehen, einem anderen sein </p><p>Vergn�gen zu rauben, wofern man nur sein eigenes erjagt, das ist in der </p><p>Tat Unrecht. Sich selber dagegen etwas zu nehmen, um es anderen zu dem, </p><p>was sie haben, noch dazuzugeben, das eben ist eine Pflicht der </p><p>Menschlichkeit und G�te und bringt einem stets mehr Gl�ck wieder ein, </p><p>als es einem nimmt. Denn die Wohltaten anderer vergelten als </p><p>Gegenleistung das gute Werk, und das blo�e Bewu�tsein, etwas Gutes getan </p><p>zu haben, sowie die Erinnerung an die wohlwollende Liebe derer, denen </p><p>man Gutes getan hat, bereiten dem Herzen eine Freude, die gr��er ist, </p><p>als es jenes Vergn�gen des K�rpers gewesen w�re, auf das man verzichtet </p><p>hat. Und endlich vergilt Gott, wovon sich ein gl�ubiges Gem�t mit </p><p>Leichtigkeit aus der Religion �berzeugt, ein kurzes und geringes </p><p>Vergn�gen dereinst mit unerme�licher und ewig w�hrender Freude. So sind </p><p>denn die Utopier nach sorgf�ltiger Untersuchung und genauer Erw�gung der </p><p>Sache zu der Ansicht gekommen, da� alle unsere Handlungen, und darunter </p><p>auch die tugendhaften selbst, letzten Endes auf das Vergn�gen und damit </p><p>auf die Gl�ckseligkeit abzielen. </p><p>Vergn�gen nennen die Utopier jede Bewegung und jeden Zustand des K�rpers </p><p>und des Geistes, worin wir unter Anleitung der Natur mit Behagen </p><p>verweilen. Nicht ohne Grund f�gen sie hinzu, da� die Natur es so haben </p><p>will. Denn von Natur bereitet alles das Wohlbehagen, was man nicht auf </p><p>dem Wege des Unrechts begehrt oder wodurch nichts anderes Angenehmeres </p><p>verlorengeht oder was keine M�he und Arbeit im Gefolge hat; und danach </p><p>verlangt nicht blo� das sinnliche Begehren, sondern auch die gesunde </p><p>Vernunft. Anderseits aber gibt es Dinge, die die Menschen gegen die </p><p>Ordnung der Natur f�lschlich als angenehm bezeichnen, und zwar auf Grund </p><p>eines ganz t�richten Sprachgebrauchs, gerade als ob wir es in der Hand </p><p>h�tten, mit den Worten auch die Dinge zu �ndern. Alle diese Dinge sind </p><p>nach Ansicht der Utopier wertlos f�r die Gl�ckseligkeit, ja sogar ihr im </p><p>h�chsten Grade hinderlich, und zwar deshalb, weil sie die ganze Seele </p><p>des Menschen, in der sie sich einmal festgesetzt haben, mit einer </p><p>verkehrten Meinung �ber das Vergn�gen im voraus erf�llen, um f�r wahre </p><p>und reine Freuden nirgends Platz zu lassen. Es gibt n�mlich sehr viele </p><p>Dinge, die zwar ihrer eigentlichen Natur nach durchaus nicht anziehend, </p><p>sondern im Gegenteil sogar meist recht unangenehm sind, die aber </p><p>trotzdem infolge der t�richten Lockung ruchloser Begierden nicht blo� </p><p>f�r die h�chsten Gen�sse gehalten, sondern auch sogar zu den wichtigsten </p><p>Angelegenheiten des Lebens gerechnet werden. </p><p>Zu denen, die den falschen Vergn�gen dieser Art nachgehen, z�hlen die </p><p>Utopier diejenigen, die sich selber, wie fr�her erw�hnt, um so besser </p><p>d�nken, je besser sie angezogen sind; dabei irren sie sich in diesem</p><p>einen Punkte zweifach. Denn sie sind nicht weniger im Irrtum, wenn sie </p><p>ihren Anzug, als wenn sie sich selbst f�r etwas Besseres halten. Warum </p><p>sollte n�mlich im Hinblick auf die Brauchbarkeit der Kleidung ein Tuch </p><p>aus feinerem Gewebe besser sein als eins aus gr�berem? Und doch ist </p><p>jenen Leuten der Kamm geschwollen, als ob sie von Natur und nicht durch </p><p>einen blo�en Irrtum etwas Besseres w�ren, und sie meinen, sie gew�nnen </p><p>auch dadurch etwas an Wert. Deshalb beanspruchen sie auch, gleich als </p><p>sei das ihr gutes Recht, f�r ihren eleganteren Anzug eine </p><p>Ehrenbezeigung, auf die sie in einfacherer Kleidung gar nicht wagen </p><p>w�rden zu hoffen, und sind unwillig, wenn sie beim Vor�bergehen nicht </p><p>weiter beachtet werden. Aber ist nicht gerade auch dieses Verlangen nach </p><p>eitlen und nutzlosen Ehrenbezeigungen ebenso unvern�nftig? Denn wie kann </p><p>wohl der entbl��te Scheitel oder das gebeugte Knie eines anderen ein </p><p>nat�rliches und wahres Vergn�gen bereiten? Wird das vielleicht einen </p><p>Schmerz in deinen eigenen Knien heilen? Oder wird es das hitzige Fieber </p><p>in deinem eigenen Kopfe lindern? In der Vorstellung eines solchen </p><p>Scheinvergn�gens schmeicheln sie sich und klatschen sie sich Beifall, </p><p>weil sie zuf�llig von Vorfahren abstammen, von denen eine lange Reihe </p><p>f�r reich gegolten hat -- einen anderen Adel gibt es ja heutzutage </p><p>nicht�--, f�r reich besonders an Landg�tern, und sie d�nken sich nicht </p><p>um ein Haar weniger vornehm, wenn ihnen auch ihre Vorfahren von ihrem </p><p>Reichtum nichts hinterlassen oder wenn sie ihr Erbe selber verpra�t </p><p>haben. </p><p>Zu den Leuten dieser Art rechnen die Utopier auch die schon erw�hnten </p><p>Liebhaber von Gemmen und Edelsteinen, und sie kommen sich gewisserma�en </p><p>wie G�tter vor, wenn sie einmal einen ausnehmend wertvollen Stein </p><p>erwerben, zumal wenn er von der zu ihrer Zeit und in ihrem Lande </p><p>besonders gesch�tzten Art ist; denn nicht �berall und nicht zu jeder </p><p>Zeit behalten die gleichen Arten ihren Wert. Sie kaufen aber einen </p><p>Edelstein nur ohne Goldfassung und Umh�llung, und auch dann nur, wenn </p><p>der Verk�ufer einen Eid und B�rgschaft daf�r leistet, da� die Gemme und </p><p>der Juwel echt sind; solche Angst haben sie, da� der Augenschein sie </p><p>t�uschen k�nnte. Warum aber sollte dir, der du den Edelstein nur </p><p>betrachten willst, ein k�nstlicher weniger Vergn�gen machen, den dein </p><p>Auge von einem echten nicht zu unterscheiden vermag? Beide m��ten </p><p>eigentlich den gleichen Wert haben, f�r dich, bei Gott, genau so wie f�r </p><p>einen Blinden. </p><p>Was soll man ferner von denen sagen, die �berfl�ssige Sch�tze </p><p>aufbewahren, nicht um sich �ber die Verwendung des Haufens Geld, sondern </p><p>nur �ber seinen Anblick zu freuen? Genie�en sie etwa eine echte Freude, </p><p>oder narrt sie nicht vielmehr nur ein Scheinvergn�gen? Oder wie steht es </p><p>mit denen, die den entgegengesetzten Fehler begehen und das Gold, das </p><p>sie niemals verwenden, ja vielleicht auch niemals wieder zu Gesicht </p><p>bekommen werden, vergraben und aus Angst vor seinem Verlust es wirklich </p><p>verlieren? Denn verlierst du dein Gold nicht, wenn du es der Verwendung </p><p>durch dich selbst und vielleicht durch die Menschen �berhaupt entziehst </p><p>und der Erde zur�ckgibst? Und doch bist du ausgelassen froh dar�ber, da� </p><p>du deinen Schatz versteckt hast, als brauchtest du nun keine Sorge mehr </p><p>zu haben. Sollte dir aber jemand den Schatz stehlen, ohne da� du etwas </p><p>von diesem Diebstahl merkst, und solltest du zehn Jahre danach sterben, </p><p>was macht es dir da in dem ganzen Zeitraum von zehn Jahren, um den du </p><p>den Verlust deines Geldes �berlebt hast, aus, ob es gestohlen oder noch </p><p>vorhanden war? Sicherlich hast du in beiden F�llen den gleichen Nutzen </p><p>davon gehabt. </p><p>Zu diesen so unpassenden Freuden rechnen die Utopier auch die der </p><p>Gl�cksspieler, deren unsinniges Gebaren ihnen nur vom H�rensagen, nicht</p><p>aus Erfahrung bekannt ist, und au�erdem die der J�ger und Vogelsteller. </p><p>Denn was ist das f�r ein Vergn�gen, so sagen sie, die W�rfel auf das </p><p>Spielbrett zu werfen? Und dabei tut man das so oft, da� schon aus der </p><p>h�ufigen Wiederholung ein �berdru� entstehen k�nnte, wenn wirklich ein </p><p>Vergn�gen damit verbunden w�re. Oder wie k�nnte es angenehm sein und </p><p>nicht vielmehr Widerwillen erregen, das Gebell und Geheul der Hunde zu </p><p>h�ren? Oder inwiefern macht es mehr Vergn�gen, wenn ein Hund einem Hasen </p><p>als wenn er einem anderen Hunde nachjagt? Denn in beiden F�llen handelt </p><p>es sich doch um den gleichen Vorgang: es wird gelaufen -- wenn dir das </p><p>Laufen Freude machen sollte. Wenn dich aber die Aussicht auf Mord </p><p>fesselt oder wenn du auf die Zerfleischung wartest, die sich vor deinen </p><p>Augen abspielen soll, so m��te es doch eher dein Mitleid erregen, wenn </p><p>du mit ansehen mu�t, wie das arme H�slein von dem Hunde zerrissen wird, </p><p>der Schwache von dem St�rkeren, der Scheue und Furchtsame von dem </p><p>Wilden, der Harmlose schlie�lich von dem Grausamen. Die Utopier haben </p><p>deshalb dieses ganze Gesch�ft des Jagens als eine der Freien unw�rdige </p><p>Besch�ftigung den Metzgern zugewiesen, deren Handwerk sie, wie oben </p><p>erw�hnt, von Sklaven aus�ben lassen. Ihrer Anschauung nach ist n�mlich </p><p>die Jagd die niedrigste Verrichtung dieses Handwerks, die �brigen sind </p><p>in ihren Augen n�tzlicher und ehrbarer, weil sie die Tiere weit mehr </p><p>schonen und nur aus Notwendigkeit t�ten, w�hrend der J�ger einzig und </p><p>allein im Morden und Zerfleischen des armen Tieres sein Vergn�gen sucht. </p><p>Dieses Lustgef�hl beim Anblick des Mordens hat nach Ansicht der Utopier </p><p>sogar beim Morden der Tiere seinen Ursprung in einer grausamen </p><p>Gem�tsstimmung oder artet schlie�lich infolge st�ndiger Wiederholung des </p><p>so rohen Vergn�gens in Grausamkeit aus. Diese und alle sonstigen Gen�sse </p><p>derart -- es gibt n�mlich deren unz�hlige -- h�lt zwar die gro�e Masse </p><p>der Menschen f�r Vergn�gen, die Utopier dagegen erkl�ren rund heraus, </p><p>mit dem wahren Vergn�gen habe das alles gar nichts zu tun, da ihm von </p><p>Natur alles Erfreuliche fehle. Denn wenn es auch f�r gew�hnlich den Sinn </p><p>mit Wohlbehagen erf�llt, was ja die Aufgabe des Vergn�gens zu sein </p><p>scheint, so gehen die Utopier doch nicht von ihrer Meinung ab. Der Grund </p><p>daf�r ist n�mlich nicht die Natur der Sache selbst, sondern die �ble </p><p>Gewohnheit der Menschen. Sie ist schuld daran, da� man Bitteres als s�� </p><p>hinnimmt, genau so wie schwangere Frauen, deren Geschmack gest�rt ist, </p><p>Pech und Talg f�r s��er als Honig halten. Aber das Urteil eines </p><p>einzelnen, das durch Krankheit oder Gew�hnung getr�bt ist, kann die </p><p>Natur nicht �ndern, die des Vergn�gens ebensowenig wie die anderer </p><p>Dinge. </p><p>Von den nach ihrer Ansicht echten Vergn�gen unterscheiden die Utopier </p><p>verschiedene Arten, und zwar weisen sie die einen der Seele und die </p><p>anderen dem Leibe zu. Zu den Vergn�gen der Seele z�hlen sie die geistige </p><p>Bet�tigung sowie das Wohlbehagen, das die Betrachtung der Wahrheit </p><p>hervorruft. Dazu kommt das angenehme Bewu�tsein eines untadeligen </p><p>Lebenswandels und die sichere Hoffnung auf die Gl�ckseligkeit nach dem </p><p>Tode. Die k�rperliche Lust zerf�llt in zwei Arten. Die erste ist die, </p><p>die unsere Sinne mit einem deutlichen Wohlbehagen erf�llt. Das geschieht </p><p>zum Teil durch die Erneuerung derjenigen Bestandteile unseres K�rpers, </p><p>die durch die W�rmeerzeugung in unserem Inneren verbraucht sind -- diese </p><p>f�hrt uns n�mlich Essen und Trinken wieder zu�--, zum Teil auch durch </p><p>Ausscheidung der in unserem K�rper �berfl�ssigen Stoffe. Das wird </p><p>erreicht durch Reinigung der Eingeweide von den Exkrementen oder durch </p><p>Zeugung von Kindern oder wenn das Jucken eines K�rperteils durch Reiben </p><p>oder Kratzen gelindert wird. Bisweilen aber entsteht auch ein Vergn�gen, </p><p>das unserem K�rper weder etwas zuf�hrt, wonach die Organe verlangen, </p><p>noch diese von etwas L�stigem befreit. Es ist aber eine Lustempfindung, </p><p>die unsere Sinne trotzdem mit einer Art geheimer Gewalt, aber in einer </p><p>deutlich sichtbaren Erregung zu kitzeln, anzuregen und an sich zu ziehen</p><p>vermag; ein solches Vergn�gen bereitet die Musik. Die zweite Art des </p><p>k�rperlichen Vergn�gens erblicken die Utopier in einem ruhigen und </p><p>gleichm��igen Zustand des K�rpers, das hei�t also in der durch keinerlei </p><p>Unbehagen gest�rten Gesundheit des einzelnen. Diese ruft ja, falls kein </p><p>Schmerz sie beeintr�chtigt, schon an und f�r sich Wohlbehagen hervor, </p><p>selbst wenn keine von au�en kommende Lust auf den K�rper einwirken </p><p>sollte. Zwar tritt sie weniger hervor und reizt die Sinne weniger als </p><p>jene ungest�me Lust an Essen und Trinken; nichtsdestoweniger jedoch </p><p>gilt sie vielen in Utopien als das gr��te, fast allen aber als ein </p><p>gro�es Vergn�gen und gleichsam als die Grundlage und der Grundstein </p><p>aller Vergn�gen. Denn sie allein macht unser Leben ruhig und lebenswert, </p><p>und ohne sie ist bei keinem und nirgends noch Raum f�r irgendein </p><p>Vergn�gen. Denn auch wenn man gar keine Schmerzen hat, dabei aber nicht </p><p>gesund ist, so ist doch dieser Zustand in den Augen der Utopier kein </p><p>Vergn�gen, sondern Stumpfheit. Schon l�ngst gilt bei ihnen die Lehre der </p><p>Philosophen nicht mehr, die da meinten, man d�rfe eine best�ndige und </p><p>ungest�rte Gesundheit deshalb nicht f�r ein Vergn�gen halten, weil das </p><p>Vorhandensein eines solchen nur infolge einer Erregung von au�en her zu </p><p>merken sei; auch diese Frage ist n�mlich eifrig bei den Utopiern </p><p>er�rtert worden. Vielmehr sind sie jetzt im Gegenteil fast alle darin </p><p>einig, da� die Gesundheit sogar ganz besonders als ein Vergn�gen </p><p>anzusehen ist. Da n�mlich mit der Krankheit, so sagen sie, der Schmerz </p><p>verbunden ist, der der unvers�hnliche Feind des Vergn�gens ist, ebenso </p><p>wie die Krankheit der Feind der Gesundheit, warum sollte dann nicht </p><p>anderseits mit einer ungest�rten Gesundheit das Vergn�gen verbunden </p><p>sein? Dabei ist es nach ihrer Ansicht ohne Belang, ob man die Krankheit </p><p>selber als Schmerz oder den Schmerz nur als Begleiterscheinung der </p><p>Krankheit bezeichnet; die Wirkung sei ja in beiden F�llen gleich stark. </p><p>Mag nun die Gesundheit entweder ein Vergn�gen an und f�r sich oder nur </p><p>seine notwendige Ursache sein, wie das Feuer die Ursache der Hitze ist, </p><p>ohne Zweifel ist die Wirkung in beiden F�llen die, da� ein Mensch, der </p><p>sich einer eisernen Gesundheit erfreut, ein Vergn�gen empfinden mu�. </p><p>Au�erdem, so sagen sie, wenn wir essen, was geschieht da anderes, als </p><p>da� die Gesundheit, die allm�hlich ersch�ttert worden war, im Bunde mit </p><p>der Speise gegen den Hunger ank�mpft? W�hrend der betreffende Mensch </p><p>selbst dabei wieder erstarkt und seine gewohnte Kraft wiedererlangt, </p><p>bereitet ihm die Gesundheit jenes Vergn�gen, das uns so erquickt. Wird </p><p>nun aber die Gesundheit, die sich schon w�hrend des Kampfes freut, nicht </p><p>erst recht froh sein, wenn sie den Sieg errungen hat? Ist sie endlich </p><p>wieder gl�cklich im Besitze ihrer alten St�rke, um die allein sie den </p><p>ganzen Kampf gef�hrt hat, wird sie dann etwa gef�hllos werden und ihr </p><p>Gl�ck nicht erkennen und keinen gro�en Wert darauf legen? Da� man </p><p>n�mlich sagt, man k�nne die Gesundheit nicht empfinden, ist nach Meinung </p><p>der Utopier ganz falsch. Wer empfindet denn nicht, so sagen sie, wenn er </p><p>nicht gerade schl�ft, da� er gesund ist, au�er dem, der es eben nicht </p><p>ist? Wer liegt in so festen Banden des Stumpfsinns oder der Lethargie, </p><p>da� er nicht zugeben sollte, die Gesundheit bereite ihm Freude und </p><p>Genu�? Was ist aber Genu� anderes als eine andere Bezeichnung f�r </p><p>Vergn�gen? </p><p>Nach alledem sch�tzen die Utopier besonders die geistigen Vergn�gen; sie </p><p>halten sie n�mlich f�r die ersten und wesentlichsten von allen, und in </p><p>der Hauptsache entstehen sie nach ihrer Meinung aus der �bung der Tugend </p><p>und dem Bewu�tsein eines rechtschaffenen Lebenswandels. Unter den </p><p>k�rperlichen Vergn�gen stellen sie die Gesundheit an erste Stelle; denn </p><p>die Annehmlichkeit des Essens und Trinkens und alle anderen </p><p>Erg�tzlichkeiten der Art betrachten sie zwar als erstrebenswert, aber </p><p>nur um der Gesundheit willen. Solcherlei n�mlich sei nicht an und f�r </p><p>sich erfreulich, sondern nur insofern, als es einer sich heimlich</p><p>einschleichenden Krankheit entgegenwirke. Wie deshalb der Verst�ndige </p><p>eher Krankheiten vorbeugen als nach Arznei verlangen und lieber die </p><p>Schmerzen beseitigen als zu Trostmitteln greifen m�sse, so sei es </p><p>besser, man habe diese Art Vergn�gen gar nicht n�tig, als da� man darin </p><p>ein Linderungsmittel erblicke. Sollte wirklich jemand in dieser Art </p><p>Vergn�gen sein Gl�ck sehen, so m�sse er notwendig zugeben, er werde dann </p><p>erst am gl�cklichsten sein, wenn ihm ein Leben in best�ndigem Hunger, </p><p>Durst, Jucken, Essen, Trinken, Kratzen und Reiben beschieden sei. Da� </p><p>ein solches Leben aber nicht blo� h��lich, sondern auch j�mmerlich w�re, </p><p>sieht jeder ein. Diese Gen�sse sind in der Tat die niedrigsten, weil sie </p><p>keineswegs reiner Natur sind; denn immer sind sie von den </p><p>entgegengesetzten Schmerzen begleitet. So ist mit dem Genu� des Essens </p><p>der Hunger verbunden, und zwar in einem recht ungleichen Verh�ltnis. </p><p>Denn der Schmerz ist nicht nur heftiger, sondern h�lt auch l�nger an, da </p><p>er ja eher als das Vergn�gen entsteht und erst zusammen mit ihm vergeht. </p><p>Vergn�gen dieser Art also sind nach Ansicht der Utopier nicht zu </p><p>sch�tzen, soweit sie nicht zum Leben notwendig sind. Doch haben sie auch </p><p>an ihnen ihre Freude und erkennen dankbar die Liebe der Mutter Natur an, </p><p>die ihre Kinder mit den verlockendsten Lustgef�hlen zu den f�r sie immer </p><p>wieder lebensnotwendigen Verrichtungen anspornt. Wie w�rde uns n�mlich </p><p>unser Leben anekeln, wenn wir ebenso wie die �brigen Krankheiten, die </p><p>uns seltener befallen, auch diese t�glichen Erkrankungen an Hunger und </p><p>Durst durch Gifte und bittere Arzneien bek�mpfen m��ten! Was dagegen </p><p>Sch�nheit, St�rke und Gewandtheit anlangt, so hegen und pflegen die </p><p>Utopier sie mit Vorliebe als eigentliche und willkommene Gaben der </p><p>Natur. Als eine Art angenehme W�rze des Lebens sch�tzen sie auch </p><p>diejenigen Gen�sse, die uns Auge, Ohr und Nase vermitteln und die die </p><p>Natur ausschlie�lich f�r den Menschen, und zwar in besonderer Weise, </p><p>geschaffen hat; denn keine andere Gattung von Lebewesen hat ein Auge f�r </p><p>die Sch�nheit des Weltgeb�udes oder wird irgendwie von Wohlger�chen </p><p>angenehm ber�hrt, soweit sie nicht ihre Nahrung danach unterscheiden, </p><p>oder hat ein Geh�r f�r die verschiedenen Abst�nde harmonischer und </p><p>dissonierender T�ne. Bei allen diesen Gen�ssen aber sehen die Utopier </p><p>darauf, da� nicht ein kleinerer einem gr��eren im Wege ist und da� </p><p>niemals ein Vergn�gen den Schmerz im Gefolge hat, was, wie sie meinen, </p><p>notwendig bei einem nicht ehrbaren Vergn�gen der Fall ist. Den Reiz der </p><p>Sch�nheit dagegen zu verachten, die Kr�fte zu schw�chen, die </p><p>Beweglichkeit zu Tr�gheit werden zu lassen, seinen K�rper durch Fasten </p><p>zu ersch�pfen, seiner Gesundheit Gewalt anzutun und auch sonst von den </p><p>Lockungen der Natur nichts wissen zu wollen, es sei denn, da� man sein </p><p>Gl�ck nur deshalb nicht wahrnimmt, um desto eifriger f�r das Wohl seiner </p><p>Mitmenschen oder f�r das des Staates besorgt zu sein -- eine M�he, f�r </p><p>die man als Entsch�digung eine gr��ere Freude von Gott erwartet�--, </p><p>aber sich zu kasteien, ohne jemandem zu n�tzen, sondern lediglich um </p><p>eines nichtigen Schattens von Tugend willen oder um Mi�geschick, das </p><p>einem aber vielleicht niemals widerf�hrt, leichter zu ertragen: das ist, </p><p>so meinen die Utopier, ganz widersinnig, eine Grausamkeit gegen sich </p><p>selbst und der bitterste Undank gegen die Natur; denn dadurch verzichtet </p><p>man auf alle ihre Wohltaten, gleich als ob man es verschm�hte, ihr </p><p>irgendwie zu Dank verpflichtet zu sein. </p><p>Das ist die Ansicht der Utopier �ber die Tugend und das Vergn�gen, und, </p><p>wie sie glauben, kann man keine finden, mit der menschliche Vernunft der </p><p>Wahrheit n�her kommt, es m��te denn sein, da� eine vom Himmel gesandte </p><p>Religion einem Menschen noch fr�mmere Gedanken eingibt. Ob sie damit </p><p>recht oder unrecht haben, k�nnen wir aus Mangel an Zeit nicht genau </p><p>untersuchen, auch ist das gar nicht n�tig; denn wir haben es ja nur </p><p>unternommen, von ihren Einrichtungen zu erz�hlen, nicht aber diese in</p><p>Schutz zu nehmen. Wie es sich aber auch mit den angef�hrten Grunds�tzen </p><p>der Utopier verhalten mag, davon bin ich fest �berzeugt: nirgends ist </p><p>das Volk t�chtiger, und nirgends ist der Staat gl�cklicher als in </p><p>Utopien. </p><p>Die Utopier sind k�rperlich gewandt und r�stig; auch besitzen sie mehr </p><p>Kr�fte, als ihre Statur erwarten l��t; doch ist diese nicht </p><p>unansehnlich. Der Boden ist zwar nicht �berall fruchtbar und das Klima </p><p>nicht besonders gesund, aber sie h�rten sich gegen die Witterung durch </p><p>eine m��ige Lebensweise so sehr ab und verbessern die Beschaffenheit des </p><p>zu bestellenden Landes mit solchem Eifer, da� nirgends in der Welt der </p><p>Ertrag an Feldfrucht und Vieh reicher ist und nirgends die Menschen </p><p>langlebiger und widerstandsf�higer gegen Krankheiten sind. Deshalb kann </p><p>man in Utopien die Landleute nicht nur die �blichen Arbeiten verrichten </p><p>sehen, wie sie die von Natur geringere Fruchtbarkeit des Bodens durch </p><p>Kunst und Flei� steigern, sondern man kann auch beobachten, wie irgendwo </p><p>ein Wald vollst�ndig ausgerodet und anderswo wieder angepflanzt wird. </p><p>Dabei gibt nicht die R�cksicht auf den Ertrag, sondern auf den Transport </p><p>den Ausschlag; das Holz soll sich n�mlich in gr��erer N�he des Meeres </p><p>oder der Fl�sse oder der St�dte selbst befinden, weil sein Transport von </p><p>weither auf dem Landwege beschwerlicher ist als der des Getreides. Die </p><p>Utopier sind ein gewandtes, witziges und kunstfertiges Volk. Es genie�t </p><p>gern seine Mu�e, besitzt aber auch n�tigenfalls gen�gend Ausdauer in </p><p>k�rperlicher Arbeit. Sonst ist es in der Tat keineswegs arbeitsw�tig, </p><p>doch kennt es keine Erm�dung, wenn es sich um geistige Interessen </p><p>handelt. </p><p>Als wir den Utopiern von der griechischen Literatur und Wissenschaft </p><p>erz�hlten -- �ber die Lateiner sprachen wir nicht, weil von ihnen, wie </p><p>wir meinten, h�chstens die Historiker und Dichter ihren lebhaften </p><p>Beifall finden w�rden�--, staunten wir, mit welchem Eifer sie darauf </p><p>bestanden, unter unserer Anleitung Griechisch gr�ndlich lernen zu </p><p>d�rfen. So begannen wir denn mit dem Unterricht, anfangs mehr deshalb, </p><p>um nicht den Anschein zu erwecken, als wollten wir uns nicht der M�he </p><p>unterziehen, als weil wir mit irgendeinem Erfolg gerechnet h�tten. </p><p>Sobald wir aber ein kleines St�ck vorangekommen waren, lie� uns ihr </p><p>Flei� erkennen, da� wir unseren Eifer nicht umsonst aufwenden w�rden; </p><p>denn die Utopier begannen, die Buchstaben so m�helos nachzuschreiben, </p><p>die Worte so gel�ufig auszusprechen, so schnell sich einzupr�gen und so </p><p>getreu zu wiederholen, da� es uns wie ein Wunder vorkam. Allerdings </p><p>geh�rten die Leute, die nicht blo� aus freien St�cken und aus </p><p>Begeisterung, sondern auch auf Grund einer Verf�gung des Senats das </p><p>Studium des Griechischen begannen, zu den erlesensten Geistern der </p><p>Gebildeten und standen in reifem Alter. Und so hatten sie denn noch vor </p><p>Ablauf von drei Jahren in ihrer sprachlichen Ausbildung keine L�cken </p><p>mehr und konnten gute Schriftsteller, abgesehen von Schwierigkeiten </p><p>infolge einer fehlerhaften Textstelle, ohne Ansto� lesen und verstehen. </p><p>Wie ich wenigstens vermute, eigneten sie sich die Kenntnis der </p><p>griechischen Sprache auch wegen ihrer teilweisen Verwandtschaft mit der </p><p>Landessprache leichter an. Ich nehme n�mlich an, die Utopier stammen von </p><p>den Griechen ab; denn in ihrer fast persisch klingenden Sprache haben </p><p>sich noch in den Orts- und Amtsnamen Spuren des Griechischen erhalten. </p><p>Im Begriff, meine vierte Seereise nach Utopien anzutreten, nahm ich an </p><p>Stelle von Waren einen ziemlich gro�en Packen B�cher mit an Bord, weil </p><p>ich fest entschlossen war, lieber gar nicht statt nach kurzer Zeit schon </p><p>heimzukehren. So besitzen denn die Utopier folgendes von mir: die </p><p>meisten Werke Platos, mehrere Schriften des Aristoteles, sodann </p><p>Theophrasts Buch �ber die Pflanzen, das aber leider an mehreren Stellen</p><p>l�ckenhaft ist. W�hrend der Seefahrt hatte ich n�mlich auf das Buch </p><p>weniger Obacht gegeben, und so hatte sich eine Meerkatze seiner </p><p>bem�chtigt und, ausgelassen und spielig, hier und da ein paar Bl�tter </p><p>herausgerissen und zerfetzt. Von den Grammatikern haben sie nur den </p><p>Lascaris; den Theodorus habe ich n�mlich gar nicht mitgenommen, ebenso </p><p>kein W�rterbuch, au�er Hesych und Dioscorides. Plutarchs kleine </p><p>Schriften haben sie sehr gern, und auch Lucians Witz und Anmut fesseln </p><p>sie. Von den Dichtern besitzen sie Aristophanes, Homer und Euripides, </p><p>ferner Sophocles in den kleinen Typen des Aldus, von den Historikern </p><p>Thucydides, Herodot sowie Herodian. Sogar aus dem Gebiet der Medizin </p><p>hatte mein Reisegef�hrte Tricius Apinatus etwas mitgebracht, n�mlich </p><p>einige kleine Schriften des Hippocrates und die Mikrotechne Galens. </p><p>Gerade auf diese beiden B�cher legen die Utopier gro�en Wert; denn wenn </p><p>sie die Heilkunde auch wohl weniger als alle anderen V�lker brauchen, so </p><p>steht sie doch nirgends in gr��erer Achtung, und zwar schon deshalb, </p><p>weil man in Utopien ihre Kenntnis zu den sch�nsten und n�tzlichsten </p><p>Teilen der Philosophie rechnet. Mit ihrer Hilfe erforscht man n�mlich </p><p>die Geheimnisse der Natur, und man glaubt, nicht blo� einen wunderbaren </p><p>Genu� davon zu haben, sondern auch die h�chste Gunst des Sch�pfers und </p><p>Werkmeisters der Natur zu gewinnen. Man ist ja der Meinung, er habe nach </p><p>Art der �brigen K�nstler den sehenswerten Mechanismus dieser Welt f�r </p><p>den Menschen zur Betrachtung ausgestellt und ihn allein in seinem </p><p>Inneren f�r eine so gewaltige Sch�pfung aufnahmef�hig gemacht, und </p><p>deshalb sei ihm ein wi�begieriger und achtsamer Betrachter und </p><p>Bewunderer seines Werkes lieber als einer, der ein so erhabenes und </p><p>wundervolles Schauspiel stumpf und unersch�ttert nicht beachtet. </p><p>So sind denn die Utopier infolge ihrer wissenschaftlichen Ausbildung </p><p>erstaunlich begabt f�r technische Erfindungen, die etwas dazu beitragen, </p><p>das Leben angenehm und bequem zu machen. Zwei Erfindungen jedoch </p><p>verdanken sie uns, die Buchdruckerkunst und die Herstellung des Papiers, </p><p>aber doch nicht uns allein, sondern zu einem guten Teile auch sich </p><p>selber. Als wir ihnen n�mlich die B�cher zeigten, die Aldus auf Papier </p><p>gedruckt hatte, und ihnen von dem zur Papierfabrikation notwendigen </p><p>Material und von den Druckverfahren mehr blo� etwas erz�hlten, statt </p><p>ihnen die Sache zu erkl�ren -- keiner von uns besa� n�mlich in einer der </p><p>beiden K�nste praktische Erfahrung�--, errieten sie sogleich �u�erst </p><p>scharfsinnig das Verfahren, und, w�hrend sie bis dahin nur auf H�uten, </p><p>Rinde und Papyrusbast schrieben, versuchten sie nunmehr sofort, Papier </p><p>herzustellen und zu drucken. Im Anfang wollte es ihnen nicht so recht </p><p>gelingen, aber durch h�ufigere Versuche kamen sie bald dahinter und </p><p>brachten es dann in beiden K�nsten so weit, da� es keinen Mangel an </p><p>Exemplaren griechischer Autoren geben k�nnte, wenn anders Handschriften </p><p>vorhanden w�ren. Zur Zeit aber steht den Utopiern nichts weiter zur </p><p>Verf�gung, als was ich erw�hnt habe; das aber haben sie bereits in </p><p>vielen tausend Exemplaren durch den Druck vervielf�ltigt. </p><p>Wer aus Schaulust nach Utopien kommt, wird mit offenen Armen </p><p>aufgenommen, wenn er sich durch eine besondere Begabung oder durch </p><p>Kenntnis vieler L�nder auszeichnet, die er sich auf langen Reisen im </p><p>Ausland erworben hat, und wenn sich seine Aufnahme dadurch empfiehlt. </p><p>Aus diesem Grunde war den Utopiern auch unsere Landung willkommen; denn </p><p>sie h�ren gern von dem Geschehen �berall in der Welt. Zu Handelszwecken </p><p>dagegen kommen Fremde nicht gerade h�ufig hin. Was sollte man denn auch </p><p>dort einf�hren au�er Eisen oder Gold und Silber, das aber jeder doch </p><p>lieber mit heimbringen m�chte? Was sie aber aus ihrem eigenen Lande </p><p>auszuf�hren haben, das verschiffen sie auf Grund reiflicher �berlegung </p><p>lieber selber, als da� sie es von anderen holen lassen, einmal, um die </p><p>V�lker des Auslands ringsum genauer kennenzulernen, und sodann, um nicht</p><p>ihrer nautischen �bung und Erfahrung verlustig zu gehen. </p><p>Die Sklaven </p><p>Als Sklaven verwenden die Utopier weder Kriegsgefangene, au�er wenn sie </p><p>selber den Krieg gef�hrt haben, noch S�hne von Sklaven noch schlie�lich </p><p>jemanden, den sie bei anderen V�lkern als Sklaven kaufen k�nnen. Ihre </p><p>Sklaven sind vielmehr Mitb�rger, die wegen eines Verbrechens zu Sklaven </p><p>gemacht, oder, was weit h�ufiger der Fall ist, Leute, die in St�dten des </p><p>Auslands wegen irgendeiner Missetat zum Tode verurteilt wurden. Von </p><p>letzteren holen sich die Utopier einen gro�en Teil ins Land; bisweilen </p><p>zahlen sie f�r sie nur einen geringen Preis, noch �fter auch gar nichts. </p><p>Diese beiden Arten von Sklaven m�ssen nicht nur dauernd arbeiten, </p><p>sondern auch Fesseln tragen. Ihre eigenen Landsleute aber behandeln die </p><p>Utopier noch h�rter; denn sie sind in ihren Augen deshalb noch </p><p>verworfener und verdienen deshalb noch schwerere Strafen, weil sie sich </p><p>trotz der vortrefflichen Anleitung zur Tugend, die sie durch eine </p><p>ausgezeichnete Erziehung gehabt haben, dennoch nicht von einem </p><p>Verbrechen haben abhalten lassen. </p><p>Eine andere Klasse von Sklaven bilden diejenigen, die es als arbeitsame </p><p>und arme Tagel�hner eines fremden Volkes vorziehen, aus freien St�cken </p><p>bei den Utopiern Sklavendienste zu leisten. Diese behandeln sie </p><p>anst�ndig und nicht viel weniger gut als ihre Mitb�rger; nur haben sie </p><p>ein klein wenig mehr Arbeit zu leisten, da sie ja daran gew�hnt sind. </p><p>Will einer von ihnen wieder fort, was aber nur selten der Fall ist, so </p><p>h�lt man ihn weder wider seinen Willen zur�ck, noch l��t man ihn ohne </p><p>irgendein Geschenk ziehen. </p><p>Die Kranken pflegt man, wie erw�hnt, mit gro�er Liebe, und man tut </p><p>unbedingt alles, um sie durch eine gewissenhafte Behandlung mit Arznei </p><p>oder Di�t wieder gesund zu machen. Sogar die, die an unheilbaren </p><p>Krankheiten leiden, sucht man zu tr�sten, indem man sich zu ihnen setzt, </p><p>sich mit ihnen unterh�lt und ihnen schlie�lich alle m�glichen </p><p>Erleichterungen schafft. Ist jedoch die Krankheit nicht blo� unheilbar, </p><p>sondern qu�lt und martert sie den Patienten auch noch dauernd, dann </p><p>stellen ihm die Priester und obrigkeitlichen Personen vor, er sei allen </p><p>Anspr�chen, die das Leben an ihn stelle, nicht mehr gewachsen, falle </p><p>anderen nur zur Last und �berlebe, sich selber zur Qual, bereits seinen </p><p>eigenen Tod. Er solle deshalb nicht darauf bestehen, seiner Krankheit </p><p>noch l�nger Gelegenheit zu geben, ihn zu verzehren; er m�ge vielmehr </p><p>ohne Z�gern seinem Leben ein Ende machen, da es ja f�r ihn nur noch eine </p><p>Qual sei, und sich in Zuversicht und guten Mutes von diesem traurigen </p><p>Leben wie von einem Kerker oder einer qu�lenden Sorge entweder selbst </p><p>frei machen oder sich mit seinem Einverst�ndnis von anderen seiner Pein </p><p>entrei�en lassen. Das werde klug sein, da er durch seinen Tod nicht das </p><p>Gl�ck, sondern nur die Qual seines Lebens vorzeitig beende; zugleich </p><p>aber werde er ein frommes und heiliges Werk vollbringen, da er ja in </p><p>diesem Falle nur den Rat der Priester, der Deuter des g�ttlichen </p><p>Willens, befolge. Wer sich nun dadurch �berreden l��t, stirbt entweder </p><p>freiwillig den Hungertod oder l��t sich bet�uben und wird so ohne eine </p><p>Todesempfindung erl�st. Gegen seinen Willen aber bringen die Utopier </p><p>niemanden ums Leben; auch lassen sie es keinem trotz seiner Weigerung, </p><p>freiwillig aus dem Leben zu scheiden, an irgendeinem Liebesdienst </p><p>fehlen. Sich �berreden zu lassen und so zu sterben, gilt als ehrenvoll. </p><p>Wer sich aber das Leben nimmt aus einem Grunde, den Priester und Senat </p><p>nicht billigen, den h�lt man weder der Beerdigung noch der Verbrennung </p><p>f�r w�rdig; zu seiner Schande l��t man ihn unbestattet und wirft ihn in</p><p>irgendeinen Sumpf. </p><p>Das Weib heiratet nicht vor dem 18., der Mann aber erst nach erf�lltem </p><p>22. Lebensjahre. Wenn ein Mann oder ein Weib vor der Ehe geheimen </p><p>Geschlechtsverkehrs �berf�hrt wird, so trifft ihn oder sie strenge </p><p>Strafe, und beide d�rfen �berhaupt nicht heiraten, es sei denn, da� der </p><p>B�rgermeister Gnade f�r Recht ergehen l��t. Aber auch der Hausvater und </p><p>die Hausmutter, in deren Hause die Schandtat begangen wurde, sind in </p><p>hohem Ma�e �bler Nachrede ausgesetzt, da sie, wie man meint, ihre </p><p>Pflicht nicht gewissenhaft genug erf�llt haben. Die Utopier ahnden </p><p>dieses Vergehen deshalb so streng, weil sich, wie sie voraussehen, nur </p><p>selten zwei Leute zu ehelicher Gemeinschaft vereinigen w�rden, wenn man </p><p>den z�gellosen Geschlechtsverkehr nicht energisch unterb�nde; denn in </p><p>der Ehe mu� man sein ganzes Leben mit nur einer Person zusammen </p><p>verbringen und au�erdem so mancherlei Beschwernis geduldig mit in Kauf </p><p>nehmen. </p><p>Ferner beobachten sie bei der Auswahl der Ehegatten mit Ernst und </p><p>Strenge einen Brauch, der uns jedoch h�chst unschicklich und �beraus </p><p>l�cherlich vorkam. Eine gesetzte, ehrbare Matrone zeigt n�mlich dem </p><p>Freier das Weib, sei es ein M�dchen oder eine Witwe, nackt; und ebenso </p><p>zeigt anderseits ein sittsamer Mann den Freier nackt dem M�dchen. Diese </p><p>Sitte fanden wir l�cherlich, und wir tadelten sie als anst��ig; die </p><p>Utopier dagegen konnten sich nicht genug �ber die auffallende Torheit </p><p>all der anderen V�lker wundern. Wenn dort, so sagten sie, jemand ein </p><p>F�llen kauft, wobei es sich nur um einige wenige Geldst�cke handelt, ist </p><p>er so vorsichtig, da� er sich trotz der fast v�lligen Nacktheit des </p><p>Tieres nicht eher zum Kaufe entschlie�t, als bis der Sattel und alle </p><p>Reitdecken abgenommen sind; denn unter diesen H�llen k�nnte ja </p><p>irgendeine schadhafte Stelle verborgen sein. Gilt es aber, eine Ehefrau </p><p>auszuw�hlen, eine Angelegenheit, die Genu� oder Ekel f�rs ganze Leben </p><p>zur Folge hat, so geht man mit solcher Nachl�ssigkeit zu Werke, da� man </p><p>das ganze Weib kaum nach einer Handbreit seines K�rpers beurteilt. Man </p><p>sieht sich nichts weiter als das Gesicht an -- der �brige K�rper ist ja </p><p>von der Kleidung verh�llt�--, und so bindet man sich an die Frau und </p><p>setzt sich dabei der gro�en Gefahr aus, da� der Ehebund keinen rechten </p><p>Halt hat, wenn sp�ter etwas Ansto� erregen sollte. Denn einerseits sind </p><p>nicht alle M�nner so klug, nur auf den Charakter zu sehen, anderseits </p><p>aber ist auch in den Ehen kluger M�nner Sch�nheit des K�rpers eine nicht </p><p>unwesentliche Zugabe zu den Vorz�gen des Geistes. Auf jeden Fall aber </p><p>k�nnen jene Kleiderh�llen eine H��lichkeit verbergen, die so absto�end </p><p>wirkt, da� sie imstande ist, Herz und Sinn eines Mannes seiner Frau </p><p>v�llig zu entfremden, da eine k�rperliche Trennung nicht mehr m�glich </p><p>ist. Wenn nun solch ein h��liches Aussehen die Folge irgendeines </p><p>Ungl�cksfalles erst nach der Heirat ist, so mu� sich jedes in sein </p><p>Schicksal f�gen; dagegen ist durch gesetzliche Bestimmungen zu verh�ten, </p><p>da� jemand vor der Eheschlie�ung einer T�uschung zum Opfer f�llt. Die </p><p>Utopier mu�ten das um so angelegentlicher ihre Sorge sein lassen, weil </p><p>sie allein von den V�lkern jener Himmelstriche sich mit nur einer Gattin </p><p>begn�gen und weil eine Ehe dort nur selten anders als durch den Tod </p><p>gel�st wird, wenn nicht gerade Ehebruch oder unertr�glich schlechte </p><p>Auff�hrung die Scheidung veranlassen. Wird n�mlich einer von beiden </p><p>Teilen auf diese Weise beleidigt, so erh�lt er vom Senat die Erlaubnis </p><p>zu einer neuen Ehe; der schuldige Teil dagegen lebt ehrlos bis an sein </p><p>Ende und darf keine neue Ehe eingehen. Da� aber jemand seine Frau, die </p><p>nichts verbrochen hat, wider ihren Willen nur deshalb verst��t, weil sie </p><p>einen k�rperlichen Unfall erlitten hat, duldet man allerdings auf keinen </p><p>Fall; denn man h�lt es f�r eine Grausamkeit, jemanden gerade dann im </p><p>Stiche zu lassen, wenn er des Trostes am meisten bedarf, und man ist der</p><p>Meinung, der alternde Gatte werde dann nicht mehr sicher und fest darauf </p><p>vertrauen k�nnen, da� ihm die eheliche Treue gehalten wird, da das Alter </p><p>Krankheiten mit sich bringt und schon an und f�r sich eine Krankheit </p><p>ist. Zuweilen jedoch kommt es vor, da� die Ehegatten charakterlich nicht </p><p>recht miteinander harmonieren. Wenn dann beide jemand anders finden, mit </p><p>dem sie gl�cklicher zu leben hoffen, so trennen sie sich in g�tlicher </p><p>Vereinbarung und gehen eine neue Ehe ein, allerdings nicht ohne </p><p>Genehmigung des Senats, der Scheidungen erst nach sorgf�ltiger </p><p>Untersuchung der Sache durch seine Mitglieder und deren Ehefrauen </p><p>zul��t. Aber auch dann machen die Senatoren die Scheidung nicht leicht, </p><p>weil sie wissen, da� die Aussicht, ohne Schwierigkeit eine neue Ehe </p><p>eingehen zu k�nnen, keineswegs dazu dient, die Liebe der Ehegatten zu </p><p>festigen. </p><p>Ehebrecher bestraft man mit �u�erst harter Sklaverei. Waren beide Teile </p><p>verheiratet, so k�nnen die Gatten, denen das Unrecht widerf�hrt, ihre </p><p>schuldigen Ehepartner versto�en und, wenn sie Lust haben, sich </p><p>gegenseitig oder, wen sie sonst wollen, heiraten. Wenn dagegen der eine </p><p>beleidigte Teil den anderen noch weiter liebt, obgleich er es so wenig </p><p>verdient, so kann die Ehe gesetzlich fortbestehen, falls der beleidigte </p><p>Teil gewillt ist, dem zur Zwangsarbeit verurteilten in die Sklaverei zu </p><p>folgen. Bisweilen erregen auch die Reue des einen und die pflichteifrige </p><p>Zuneigung des anderen Teiles das Mitleid des B�rgermeisters, so da� er </p><p>dem schuldigen Gatten wieder die Freiheit erwirkt. Wer aber dann </p><p>r�ckf�llig wird, mu� mit dem Leben b��en. </p><p>F�r die �brigen Verbrechen sieht das Gesetz keine bestimmten Strafen </p><p>vor, sondern der Senat setzt in jedem Falle, je nachdem ihm das Vergehen </p><p>schwer erscheint oder nicht, die Strafe fest. Die M�nner z�chtigen ihre </p><p>Frauen und die Eltern ihre Kinder, wenn die Missetat nicht so schlimm </p><p>ist, da� das Interesse der Moral eine �ffentliche Bestrafung verlangt. </p><p>In der Regel ahndet man die schwersten Verbrechen mit Zwangsarbeit; denn </p><p>man ist der Meinung, das sei f�r die Verbrecher nicht weniger hart und </p><p>zugleich f�r den Staat nicht weniger vorteilhaft, als wenn man die </p><p>Schuldigen schleunigst abschlachte und stracks aus dem Wege schaffe. </p><p>Einmal n�mlich bringt ihre Arbeit mehr Nutzen als ihre Hinrichtung, und </p><p>sodann schrecken sie durch ihr warnendes Beispiel f�r l�ngere Zeit </p><p>andere von �hnlicher Untat ab. Sollten sie sich aber in solcher Lage </p><p>widersetzlich und aufs�ssig benehmen, so schl�gt man sie schlie�lich tot </p><p>wie wilde Tiere, die weder Kerker noch Ketten b�ndigen k�nnen. Denen </p><p>aber, die sich geduldig f�gen, nimmt man nicht g�nzlich jede Hoffnung. </p><p>Wenn n�mlich eine lange Leidenszeit ihren Widerstand gebrochen hat und </p><p>wenn sie eine Reue zur Schau tragen, die bekundet, da� sie ihre Schuld </p><p>mehr dr�ckt als ihre Strafe, so wird ihre Zwangsarbeit bisweilen durch </p><p>ein Wort des B�rgermeisters, bisweilen aber auch durch Volksbeschlu� </p><p>entweder erleichtert oder erlassen. </p><p>Wer zur Unzucht verleitet, setzt sich ebenso gro�er Gefahr aus wie der, </p><p>der sie begeht. Bei jeder Schandtat kommt n�mlich in den Augen der </p><p>Utopier der bestimmte und wohl�berlegte Versuch der Tat selbst gleich; </p><p>denn, so meinen sie, was den Versuch nicht zur Tat werden lie�, darf dem </p><p>nicht zum Vorteil gereichen, an dem es gar nicht gelegen hat, da� der </p><p>Versuch nicht zur Tat wurde. -- Possenrei�er machen den Utopiern viel </p><p>Spa�. Sie zu beleidigen ist in ihren Augen eine gro�e Ungeh�rigkeit. </p><p>Doch finden sie nichts dabei, wenn man sich mit ihrer Torheit einen Spa� </p><p>macht; denn das ist nach ihrer Meinung f�r die Possenrei�er selber von </p><p>gr��tem Vorteil. Ist aber jemand so ernst und finster, da� er �ber </p><p>nichts, was ein Narr tut oder spricht, lacht, so darf man ihrer Ansicht </p><p>nach einen Narren seiner Obhut nicht anvertrauen; sie f�rchten n�mlich,</p><p>er werde ihn nicht nachsichtig genug behandeln, weil er von ihm nicht </p><p>nur keinen Nutzen, sondern nicht einmal Erheiterung haben werde, und </p><p>diese Begabung ist ja seine einzige St�rke. </p><p>Einen Mi�gestalteten und Kr�ppel zu verlachen, ist nach Meinung der </p><p>Utopier schimpflich und h��lich, und zwar nicht f�r den, der verspottet </p><p>wird, sondern f�r den Sp�tter; denn dieser ist so t�richt, jemandem </p><p>etwas als Fehler zum Vorwurf zu machen, was zu vermeiden gar nicht in </p><p>seiner Macht lag. Wie es n�mlich in den Augen der Utopier einerseits </p><p>eine Nachl�ssigkeit und Tr�gheit ist, sich seine k�rperliche Sch�nheit </p><p>nicht zu erhalten, so ist es anderseits eine Schande und </p><p>Unversch�mtheit, die Schminke zu Hilfe zu nehmen. Wissen sie doch aus </p><p>pers�nlicher Erfahrung, da� eine Frau die Achtung und Liebe ihres Mannes </p><p>durch keinerlei Aufputz des �u�eren in gleicher Weise wie durch </p><p>Sittsamkeit und Ehrerbietung gewinnt. Wenn sich n�mlich auch manche </p><p>M�nner durch blo�e Sch�nheit fangen lassen, so ist doch keiner ohne </p><p>Tugend und Gehorsam auf die Dauer festzuhalten. </p><p>Die Utopier schrecken nicht blo� durch Strafen von Schandtaten ab, </p><p>sondern geben auch durch die Aussicht auf Ehrungen einen Anreiz zur </p><p>Tugendhaftigkeit. Zu diesem Zweck errichten sie ber�hmten und um den </p><p>Staat besonders verdienten M�nnern auf dem Markte Standbilder zur </p><p>Erinnerung an ihre Taten; zugleich aber soll der Ruhm der Vorfahren ihre </p><p>Nachkommen mit Nachdruck zur Tugend anspornen. </p><p>Wer sich ein Amt zu erschleichen sucht, geht der Aussicht verlustig, </p><p>�berhaupt ein Amt zu erlangen. </p><p>Die Utopier verkehren in liebevoller Weise miteinander, und auch die </p><p>obrigkeitlichen Personen sind weder anma�end noch schroff. Sie hei�en </p><p>V�ter, und als solche zeigen sie sich auch. Aus freien St�cken erweist </p><p>man ihnen die geb�hrende Ehre, und man l��t sich nicht dazu zwingen. </p><p>Nicht einmal den B�rgermeister macht eine besondere Tracht oder ein </p><p>Diadem kenntlich, sondern nur ein B�schel �hren, das er tr�gt, wie das </p><p>Kennzeichen des Oberpriesters eine Wachskerze ist, die ihm vorangetragen </p><p>wird. </p><p>Gesetze haben die Utopier in ganz geringer Zahl; f�r Leute von solcher </p><p>Disziplin gen�gen ja auch �beraus wenige. Ja, das mi�billigen sie vor </p><p>allem anderen bei fremden V�lkern, da� dort nicht einmal eine Flut von </p><p>Gesetzb�chern und Kommentaren ausreicht. Ihnen selbst aber kommt es </p><p>h�chst unbillig vor, wenn sich jemand durch Gesetze verpflichten soll, </p><p>die entweder zu zahlreich sind, als da� er sie durchlesen k�nnte, oder </p><p>zu dunkel, als da� sie jedermann verst�ndlich w�ren. Ferner wollen sie </p><p>von Advokaten �berhaupt nichts wissen, weil diese die Prozesse so </p><p>gerissen f�hren und �ber die Gesetze so spitzfindig disputieren. Nach </p><p>Ansicht der Utopier ist es n�mlich von Vorteil, wenn jeder seine Sache </p><p>selber vertritt und das, was er seinem Anwalt erz�hlen w�rde, dem </p><p>Richter mitteilt; auf diese Weise werde es, so sagen sie, weniger </p><p>Winkelz�ge geben und die Wahrheit komme eher ans Licht. Wenn n�mlich </p><p>jemand spricht, den kein Anwalt Falschheit gelehrt hat, so w�gt der </p><p>Richter das einzelne, was er vorbringt, geschickt und klug ab und steht </p><p>Leuten von harmloserem Charakter gegen die Verleumdungen verschlagener </p><p>Gegner bei. Das l��t sich bei anderen V�lkern wegen der Riesenmenge </p><p>h�chst verwickelter Gesetze nur schwer durchf�hren, bei den Utopiern </p><p>dagegen ist jeder einzelne gesetzeskundig. Einmal n�mlich ist die Zahl </p><p>ihrer Gesetze, wie gesagt, sehr gering, und sodann halten sie die am </p><p>wenigsten gek�nstelte Auslegung f�r die gegebenste. Denn wenn alle </p><p>Gesetze, so sagen sie, nur dazu erlassen werden, jedermann an seine</p><p>Pflicht zu erinnern, so wird dieser Zweck durch eine feinere Auslegung, </p><p>die nur wenige verstehen, auch nur bei sehr wenigen erreicht; dagegen </p><p>ist eine einfachere und n�herliegende Erkl�rung der Gesetze einem jeden </p><p>verst�ndlich. Was aber nun die gro�e Masse anlangt, die an Zahl st�rkste </p><p>Klasse, die der Ermahnung am meisten bedarf, was macht es der aus, ob </p><p>man �berhaupt kein Gesetz gibt oder ob man ein schon bestehendes Gesetz </p><p>in einem Sinne auslegt, den jemand nur mit viel Geist und in langer </p><p>Er�rterung herausfinden kann? Damit kann sich weder der hausbackene </p><p>Verstand des gemeinen Mannes befassen, noch l��t ihm sein Leben, das von </p><p>der Beschaffung des Unterhaltes ausgef�llt ist, die Zeit dazu. </p><p>Diese Vorz�ge der Utopier veranlassen ihre Nachbarn, obwohl sie frei und </p><p>selbst�ndig sind -- viele von ihnen sind durch die Utopier schon vor </p><p>alters von der Tyrannei befreit worden�--, sich von ihnen ihre </p><p>obrigkeitlichen Personen, teils auf je ein Jahr, teils auf f�nf Jahre, </p><p>zu erbitten. Nach Ablauf ihrer Amtszeit geleiten die Fremden sie mit </p><p>Ehre und Lob nach Utopien zur�ck und nehmen wieder neue Leute in die </p><p>Heimat mit. Und diese V�lker sorgen in der Tat aufs beste f�r das </p><p>Wohlergehen ihres Staates. Da n�mlich dessen Heil und Verderben von der </p><p>F�hrung der Beamten abh�ngt, h�tten sie keine kl�gere Wahl treffen </p><p>k�nnen. Denn einerseits sind diese Fremden durch keinerlei Bestechung </p><p>vom Wege der Tugend abzubringen, da sie ja bei ihrer bald wieder </p><p>erfolgenden Heimkehr nicht lange Nutzen von dem Gelde haben w�rden; </p><p>anderseits sind ihnen die fremden B�rger unbekannt, und so lassen sie </p><p>sich nicht von unangebrachter Zuneigung oder Abneigung gegen irgend </p><p>jemand leiten. Wo aber diese beiden �bel, Parteilichkeit und Geldgier, </p><p>die Urteile beeinflussen, da ert�ten sie sogleich alle Gerechtigkeit, </p><p>den Lebensnerv des staatlichen Lebens. Diese V�lker, die sich von den </p><p>Utopiern ihre Obrigkeiten erbitten, werden von ihnen Genossen genannt, </p><p>die �brigen aber, denen sie Wohltaten erwiesen haben, Freunde. </p><p>B�ndnisse, wie sie die �brigen V�lker so oft untereinander abschlie�en, </p><p>brechen und wieder erneuern, gehen die Utopier mit keinem Volke ein. </p><p>Wozu denn ein B�ndnis? sagen sie. Gen�gen nicht die nat�rlichen Bande </p><p>der Menschen untereinander? Wer diese nicht achtet, sollte der sich etwa </p><p>durch Worte gebunden f�hlen? Zu dieser Ansicht kommen die Utopier wohl </p><p>besonders dadurch, da� in jenen L�ndern B�ndnisse und Vertr�ge der </p><p>F�rsten in der Regel zu wenig gewissenhaft gehalten werden. Und in der </p><p>Tat ist in Europa, und zwar vor allem in den Teilen, wo christlicher </p><p>Glaube und christliche Religion herrschen, die Majest�t der Vertr�ge </p><p>�berall heilig und unverletzlich, teils infolge der Gerechtigkeit und </p><p>Redlichkeit der F�rsten selbst, teils infolge der Ehrerbietung und Scheu </p><p>der Geistlichkeit gegen�ber, die selber keine Verpflichtung auf sich </p><p>nimmt, ohne sie aufs gewissenhafteste einzuhalten, die aber auch </p><p>s�mtlichen �brigen F�rsten befiehlt, ihre Versprechen auf alle Weise zu </p><p>erf�llen, dagegen diejenigen, die sich weigern, mit strenger </p><p>Kirchenstrafe dazu zwingt. Mit Recht f�rwahr meinen sie, es m��te h�chst </p><p>schimpflich erscheinen, wenn die B�ndnisse jener M�nner Treu und Glauben </p><p>vermissen lie�en, die in besonderem Sinne �Gl�ubige� hei�en. In jener </p><p>neuen Welt dagegen, die von der unsrigen fast weniger noch durch den </p><p>�quator als durch Lebensweise und Sitten geschieden ist, kann man sich </p><p>auf Vertr�ge �berhaupt nicht verlassen. Je zahlreicher und feierlicher </p><p>die Formalit�ten sind, mit denen ein Vertrag gleichsam verknotet ist, um </p><p>so schneller wird er gebrochen, weil es keine M�he macht, seinen </p><p>Wortlaut zu verdrehen. Die Leute dort setzen n�mlich einen Vertrag </p><p>bisweilen ganz verzwickt auf. Infolgedessen sind sie auch niemals auf </p><p>Grund so fester Bindungen zu fassen, da� sie nicht durch irgendeine </p><p>Masche entschl�pfen und in gleicher Weise mit der Vertragstreue Spott </p><p>und Hohn treiben k�nnten. Wenn sie solch eine hinterlistige Gesinnung,</p><p>ja solch einen Lug und Trug in einem Vertrag von Privatleuten f�nden, so </p><p>w�rden sie unter starkem Stirnrunzeln laut schreien, das sei ein </p><p>Verbrechen, das den Galgen verdiene, und nat�rlich gerade die Leute, die </p><p>sich r�hmen, ihren F�rsten selber dazu geraten zu haben. Die Folge davon </p><p>ist, da� entweder die gesamte Gerechtigkeit nur als eine niedrige Tugend </p><p>des gemeinen Mannes erscheint, die sich tief unter den Thron des K�nigs </p><p>duckt, oder da� es zum mindesten zwei Arten von Gerechtigkeit gibt. Die </p><p>eine kommt dem gemeinen Manne zu, geht zu Fu�, kriecht am Boden und ist </p><p>ringsum von zahlreichen Fesseln gehemmt, um nirgends eine Umz�unung </p><p>�berspringen zu k�nnen. Die andere ist die Tugend der F�rsten, erhabener </p><p>als die des Volkes, aber in ebenso weitem Abstand auch freier, die sich </p><p>alles erlauben darf, was ihr gef�llt. </p><p>Diese Treulosigkeit der F�rsten in jenen L�ndern, die ihre Vertr�ge so </p><p>schlecht halten, ist meiner Meinung nach auch der Grund, da� die Utopier </p><p>grunds�tzlich keine abschlie�en; m�glicherweise aber w�rden sie ihre </p><p>Ansicht �ndern, wenn sie hier lebten. Freilich erscheint es ihnen </p><p>�berhaupt als ein unheilvoller Brauch, ein B�ndnis einzugehen, mag es </p><p>auch noch so gewissenhaft gehalten werden. Denn es veranla�t die V�lker </p><p>zu der Annahme, da� sie zu gegenseitiger Feindschaft im �ffentlichen wie </p><p>im privaten Leben geschaffen seien und da� sie mit Fug und Recht </p><p>gegeneinander w�ten, falls nicht B�ndnisse dem im Wege stehen, gerade </p><p>als ob keinerlei nat�rliche Gemeinschaft zwei V�lker miteinander </p><p>verb�nde, die nur ein winziger Zwischenraum, sei es ein H�gel oder ein </p><p>Bach, trennt. Ja, selbst wenn Vertr�ge abgeschlossen sind, so erw�chst </p><p>daraus nach ihrer Ansicht noch keine Freundschaft; es bleibt vielmehr </p><p>immer noch die M�glichkeit, den anderen zu �bervorteilen, soweit man es </p><p>aus Unbedachtsamkeit bei der Festsetzung des Wortlauts unterlassen hat, </p><p>mit gen�gender Vorsicht eine Bestimmung mit aufzunehmen, die jene </p><p>M�glichkeit ausschlie�t. Die Utopier aber sind im Gegenteil der Meinung, </p><p>man d�rfe niemanden als Feind betrachten, der einem kein Unrecht getan </p><p>hat. In ihren Augen ist die Gemeinschaft der Natur so gut wie ein </p><p>B�ndnis und bindet die Menschen durch gegenseitiges Wohlwollen st�rker </p><p>und fester aneinander als durch Vertr�ge, durch die Gesinnung st�rker </p><p>und fester als durch Worte. </p><p>Das Kriegswesen </p><p>Den Krieg verabscheuen die Utopier als etwas ganz Bestialisches mehr als </p><p>alles andere, und doch gibt sich mit ihm keine Art von Bestien so </p><p>dauernd ab wie der Mensch. Der Anschauung fast aller V�lker zuwider </p><p>halten die Utopier nichts f�r so unr�hmlich wie den Ruhm, den man im </p><p>Kriege gewinnt. M�gen sie sich nun auch best�ndig an daf�r festgesetzten </p><p>Tagen in der Kriegskunst �ben, und zwar nicht blo� die M�nner, sondern </p><p>auch die Frauen, um im Bedarfsfalle kriegst�chtig zu sein, so beginnen </p><p>sie einen Krieg doch nicht ohne weiteres, sondern nur zum Schutze ihrer </p><p>eigenen Grenzen oder zur Vertreibung der ins Land ihrer Freunde </p><p>eingedrungenen Feinde oder aus Mitleid mit irgendeinem Volk, das unter </p><p>dem Drucke der Tyrannei leidet, um es mit ihrer eigenen Macht vom </p><p>Sklavenjoch des Tyrannen zu befreien, und das tun sie lediglich aus </p><p>Menschenliebe. Ihren Freunden indessen leisten sie ihre Hilfe nicht </p><p>immer nur zur Verteidigung, sondern bisweilen auch, damit diese ein </p><p>Unrecht, das man ihnen zugef�gt hat, vergelten und r�chen k�nnen. Jedoch </p><p>greifen die Utopier erst dann ein, wenn man sie noch vor Beginn der </p><p>Feindseligkeiten um Rat fragt, wenn sie den Kriegsgrund billigen, wenn </p><p>das, worum der Streit geht, zwar zur�ckgefordert, aber noch nicht </p><p>zur�ckgegeben ist, und wenn auf ihre Veranlassung hin der Krieg begonnen </p><p>wird. Dazu entschlie�en sie sich nicht nur dann, wenn ihren Freunden bei</p><p>einem feindlichen Einfall Beute geraubt wird, sondern auch dann, und </p><p>zwar mit noch weit gr��erer Erbitterung, wenn sich deren Kaufleute </p><p>irgendwo in der Welt unter dem Scheine des Rechts eine Rechtsverdrehung </p><p>gefallen lassen m�ssen indem man entweder unbillige Gesetze zum Vorwand </p><p>nimmt oder gute verkehrt auslegt. Und so kam es auch zu dem Kriege, den </p><p>die Utopier kurz vor unserer Zeit f�r die Nephelogeten gegen die </p><p>Alaopoliten f�hrten, aus keinem anderen Grunde, als weil den Kaufleuten </p><p>der Nephelogeten im Lande der Alaopoliten unter dem Scheine des Rechts </p><p>Unrecht getan worden war, wenigstens wie es den Utopiern schien. Mochte </p><p>es sich nun in diesem Falle um Recht oder Unrecht handeln, jedenfalls </p><p>kam es zu einem Rachekrieg, in dem sich zu den Streitkr�ften und dem Ha� </p><p>beider Parteien auch noch die Leidenschaften und Hilfsmittel der </p><p>Nachbarv�lker gesellten und der dadurch so blutig wurde, da� die </p><p>bl�hendsten V�lker zum Teil stark ersch�ttert, zum Teil schwer </p><p>heimgesucht wurden und immer ein �bel aus dem anderen entstand. Das </p><p>Ungl�ck endete schlie�lich mit der Versklavung und Unterwerfung der </p><p>Alaopoliten, die so unter die Herrschaft der Nephelogeten kamen -- die </p><p>Utopier k�mpften n�mlich nicht f�r ihre eigenen Interessen�--, die </p><p>Nephelogeten aber waren in der Bl�tezeit der Alaopoliten keineswegs mit </p><p>diesen zu vergleichen gewesen. </p><p>Mit solchem Nachdruck r�chen die Utopier ein ihren Freunden zugef�gtes </p><p>Unrecht, auch wenn es sich dabei nur um Geld handelt; in ihren eigenen </p><p>Angelegenheiten dagegen zeigen sie nicht den gleichen Eifer. Wenn sie </p><p>n�mlich einmal irgendwo betrogen werden und eine Einbu�e an Geld und Gut </p><p>dabei erleiden, so gehen sie in ihrem Zorn, vorausgesetzt, da� mit dem </p><p>Verlust kein Schaden an Leib und Seele verbunden ist, nur so weit, da� </p><p>sie bis zur Leistung von Genugtuung mit dem betreffenden Volke keinen </p><p>Handel mehr treiben. Dabei liegen ihnen die Interessen ihrer Mitb�rger </p><p>nicht etwa weniger am Herzen als die ihrer Genossen; �ber deren </p><p>Geldverlust aber sind sie trotzdem deshalb aufgebrachter, weil die </p><p>Kaufleute ihrer Freunde unter der Einbu�e schwer zu leiden haben, da </p><p>diese etwas von ihrem Privatbesitz verlieren, ihren Mitb�rgern dagegen </p><p>nur etwas auf Rechnung des Staates verlorengeht, �berdies nur von daheim </p><p>reichlich vorhandenem und in gewissem Sinne �berfl�ssigem Gut -- sonst </p><p>k�nnte man es ja nicht ins Ausland ausf�hren�--, so da� der einzelne den </p><p>Verlust gar nicht so empfindet. Deshalb ist es in den Augen der Utopier </p><p>auch eine zu gro�e Grausamkeit, durch den Tod vieler einen Schaden zu </p><p>r�chen, dessen nachteilige Folgen keiner von ihnen weder am Leben noch </p><p>am Lebensbedarf deutlich zu sp�ren bekommt. Wird jedoch einer ihrer </p><p>Landsleute irgendwo auf ungerechte Weise mi�handelt oder gar get�tet, so </p><p>lassen die Utopier den Tatbestand durch ihre Gesandten ermitteln, ganz </p><p>gleich, ob der Anschlag vom Staat oder von einer Privatperson </p><p>ausgegangen ist, und sind nur durch Auslieferung der Schuldigen von </p><p>einer sofortigen Kriegserkl�rung abzuhalten. Die Ausgelieferten </p><p>bestrafen sie f�r ihr Vergehen entweder mit dem Tode oder mit </p><p>Sklavenarbeit. </p><p>Ein blutiger Sieg bereitet den Utopiern nicht nur Verdru�, sondern sie </p><p>sch�men sich sogar seiner, weil sie sich sagen, es sei eine Torheit, </p><p>auch noch so kostbare Waren zu teuer zu kaufen. Haben sie aber durch </p><p>Geschick und List den Sieg errungen und den Feind bezwungen, so prahlen </p><p>sie laut damit, feiern aus diesem Anla� von Staats wegen einen Triumph </p><p>und errichten ein Siegesdenkmal, als h�tten sie eine Heldentat </p><p>vollbracht. Ihrer Mannhaftigkeit und Tapferkeit r�hmen sie sich n�mlich </p><p>immer erst dann, wenn sie so gesiegt haben, wie es kein Lebewesen au�er </p><p>dem Menschen vermocht h�tte, das hei�t mit den Kr�ften des Geistes. Denn </p><p>mit den Kr�ften des K�rpers, so sagen sie, f�hren B�ren, L�wen, Eber, </p><p>W�lfe, Hunde und die �brigen wilden Tiere den Kampf; die meisten von</p><p>ihnen sind uns zwar an Kraft und Wildheit �berlegen, aber alle zusammen </p><p>�bertreffen wir an Geist und Vernunft. </p><p>Nur das eine haben die Utopier bei einem Kriege im Auge: das zu </p><p>erreichen, was sie schon fr�her h�tten erreichen m�ssen, um sich den </p><p>Krieg zu ersparen; oder wenn das sachlich unm�glich ist, so nehmen sie </p><p>an denen, die sie f�r schuldig halten, eine so grimmige Rache, da� der </p><p>Schrecken Leute, die dasselbe wagen wollten, in Zukunft davon abh�lt. </p><p>Das sind die Ziele, die sie sich f�r ihr Vorhaben stecken und die sie </p><p>rasch zu erreichen suchen, aber so, da� sie mehr darauf bedacht sind, </p><p>die Gefahr zu vermeiden, als Lob und Ruhm zu ernten. Deshalb lassen sie </p><p>sogleich nach der Kriegserkl�rung heimlich und zu gleicher Zeit an den </p><p>Punkten des feindlichen Landes, die am besten zu sehen sind, </p><p>Proklamationen, die das Siegel ihres Staates tragen, in gro�er Zahl </p><p>anschlagen. In ihnen versprechen sie dem, der den gegnerischen F�rsten </p><p>umbringt, riesige Belohnungen; sodann setzen sie geringere, aber </p><p>gleichwohl noch recht ansehnliche Preise auf die K�pfe einzelner </p><p>Personen, die sie in denselben Anschl�gen namentlich anf�hren. Das sind </p><p>die M�nner, die sie n�chst dem F�rsten selber f�r die Urheber des Planes </p><p>halten, den man gegen sie geschmiedet hat. Welchen Betrag sie aber auch </p><p>f�r den M�rder aussetzen, sie zahlen ihn in doppelter H�he dem, der </p><p>ihnen einen von den Ge�chteten lebend bringt, und ebenso suchen sie die </p><p>Ge�chteten selbst durch die gleichen Belohnungen und au�erdem durch die </p><p>Zusicherung von Straflosigkeiten gegen ihre Genossen aufzuhetzen. So </p><p>kommt es schnell dahin, da� jene auch die anderen Menschen mit Argwohn </p><p>betrachten, sich einander selbst kein rechtes Vertrauen mehr schenken </p><p>und auch keine rechte Treue mehr halten und daher in gr��ter Furcht und </p><p>nicht geringerer Gefahr leben. Denn, wie bekannt, ist es schon mehr als </p><p>einmal vorgekommen, da� die Ge�chteten zu einem gro�en Teil und vor </p><p>allem der F�rst selber von denen verraten wurden, auf die sie die gr��te </p><p>Hoffnung setzten. So leicht verleiten Belohnungen zu jedem beliebigen </p><p>Verbrechen. F�r diese Pr�mien setzen die Utopier auch keine bestimmte </p><p>H�he fest. Indem sie vielmehr die Gr��e der Gefahr bedenken, zu der sie </p><p>verleiten, bem�hen sie sich, sie durch die H�he der Belohnungen </p><p>aufzuwiegen, und aus diesem Grunde stellen sie nicht nur eine </p><p>unerme�liche Menge Gold in Aussicht, sondern auch recht ertragreiche </p><p>Landg�ter an ganz sicheren Orten in den L�ndern ihrer Freunde, und zwar </p><p>als dauernden Besitz, und halten ihr Versprechen mit gewissenhafter </p><p>Treue. Dieser Brauch, den Feind gegen Gebot zu kaufen, den andere V�lker </p><p>als Beweis einer entarteten Gesinnung und als grausame Untat verwerfen, </p><p>ist in den Augen der Utopier ein hohes Lob. Ja, sie d�nken sich auch </p><p>klug, weil sie auf diese Weise die gr��ten Kriege ohne jeden Kampf </p><p>v�llig zu Ende bringen, und sogar human und mitleidsvoll, weil sie mit </p><p>dem Tode einiger weniger Schuldiger das Leben zahlreicher Unschuldiger </p><p>erkaufen, die sonst im Kampfe gefallen w�ren, teils aus den Reihen der </p><p>Ihrigen, teils aus denen der Feinde, deren Menge und Masse sie fast </p><p>ebenso bedauern wie ihre eigenen Landsleute; wissen sie doch recht wohl, </p><p>da� jene einen Krieg nicht aus freien St�cken anfangen, sondern weil die </p><p>blinde Leidenschaft ihrer F�rsten sie dazu treibt. Kommen sie auf diese </p><p>Weise nicht weiter, so s�en und n�hren sie Zwietracht, indem sie dem </p><p>Bruder des F�rsten oder sonst einem aus dem Adel Hoffnung auf den Thron </p><p>machen. Wenn die Parteien im Inneren versagen, so wiegeln die Utopier </p><p>die Nachbarv�lker des Feindes auf und verwickeln sie in einen Krieg mit </p><p>ihm, indem sie irgendeinen alten Vorwand hervorsuchen, woran es ja </p><p>K�nigen niemals fehlt. </p><p>Haben sie diesen V�lkern ihren Beistand im Kriege versprochen, so </p><p>stellen sie ihnen reichlich Geld zur Verf�gung, Hilfskr�fte aus den </p><p>Reihen ihrer B�rger jedoch nur ganz sp�rlich; denn diese sind ihnen so</p><p>au�erordentlich lieb und wert, und sie sch�tzen sich gegenseitig so </p><p>hoch, da� sie einen ihrer Landsleute nur ungern gegen den feindlichen </p><p>F�rsten austauschen w�rden. Gold und Silber dagegen, dessen gesamte </p><p>Menge sie einzig und allein f�r diesen Zweck aufbewahren, geben sie von </p><p>Herzen gern hin; sie k�nnten ja ebenso bequem leben, auch wenn sie es </p><p>vollst�ndig aufbrauchten. Denn au�er dem Reichtum im Inland besitzen sie </p><p>ja noch, wie fr�her erw�hnt, bei den meisten V�lkern des Auslands einen </p><p>unerme�lichen Schatz von Guthaben. So werben sie denn �berall S�ldner </p><p>an, vornehmlich aus dem Volk der Zapoleten, und lassen sie in den Krieg </p><p>ziehen. </p><p>Diese wohnen 500 Meilen �stlich von Utopien. Unkultiviert, roh und wild, </p><p>wie sie sind, lassen sie deutlich merken, da� sie inmitten von W�ldern </p><p>und rauhen Bergen aufgewachsen sind. Sie sind ein kr�ftiger Volksstamm, </p><p>unempfindlich gegen Hitze, K�lte und Anstrengung, unbekannt mit allen </p><p>Annehmlichkeiten des Lebens, nicht begeistert f�r den Ackerbau, </p><p>nachl�ssig in Wohnung und Kleidung und nur f�r die Viehzucht </p><p>interessiert. Zu einem gro�en Teile leben sie von Jagd und Raub. Einzig </p><p>und allein zum Krieg geboren, suchen die Zapoleten eifrig nach einer </p><p>Gelegenheit zur Teilnahme an einem solchen, und finden sie eine, so </p><p>ergreifen sie sie mit Leidenschaft, ziehen in gro�er Zahl au�er Landes </p><p>und bieten sich f�r wenig Geld dem ersten besten an, der Soldaten sucht. </p><p>Dies Handwerk, den Tod zu suchen, ist das einzige ihres Lebens, das sie </p><p>verstehen. F�r ihren Dienstherrn schlagen sie sich mit Hingebung und </p><p>unbestechlicher Treue. Doch verpflichten sie sich nicht bis zu einem </p><p>bestimmten Termin, sondern wenn sie Partei ergreifen, so tun sie das nur </p><p>unter der Bedingung, da� sie am n�chsten Tage auf seiten des Feindes </p><p>stehen d�rfen, falls dieser ihnen h�heren Sold bietet; ebenso kehren sie </p><p>dann am �bern�chsten Tage, durch eine Kleinigkeit Geld mehr verlockt, </p><p>wieder zur�ck. Nur selten kommt es zu einem Kriege, in dem sie nicht zu </p><p>einem gro�en Teile auf beiden Seiten k�mpfen. So werden t�glich </p><p>Blutsverwandte, bisher S�ldner der gleichen Partei und einander die </p><p>besten Kameraden, bald darauf auseinandergerissen, geraten in </p><p>feindliche Heere, treffen als Gegner aufeinander und metzeln sich </p><p>gegenseitig nieder wie erbitterte Feinde, die ihre Abstammung vergessen </p><p>haben und nicht mehr an ihre fr�here Freundschaft denken. Dabei </p><p>veranla�t sie kein anderer Grund zur gegenseitigen Vernichtung, als da� </p><p>zwei feindliche F�rsten sie f�r ein paar lumpige Geldst�cke gemietet </p><p>haben. Dieses Geld berechnen sie sich so genau, da� sie sich durch die </p><p>Erh�hung des t�glichen Soldes um nur einen Heller zu einem Wechsel der </p><p>Partei verleiten lassen. So hat sich in ihren Herzen rasch die Habgier </p><p>eingenistet, von der sie jedoch keinen Vorteil haben; was sie n�mlich </p><p>mit ihrem Blute gewinnen, verbrauchen sie alsbald wieder mit einer </p><p>Verschwendung, die gleichwohl armselig ist. </p><p>Dieses Volk k�mpft f�r die Utopier gegen alle Welt, weil niemand </p><p>anderswo seine Dienstleistung so gut bezahlt wie diese. Wie sich n�mlich </p><p>die Utopier nach guten Menschen umsehen, um sie in ihrem Dienst n�tzlich </p><p>zu verwenden, so werben sie auch diese Schurken an, um sie zu </p><p>mi�brauchen. N�tigenfalls machen sie ihnen lockende Versprechungen und </p><p>setzen sie an den gef�hrlichsten Punkten ein. Meist kommt dann ein </p><p>gro�er Teil von ihnen niemals wieder zur�ck und kann die versprochenen </p><p>Belohnungen gar nicht anfordern. Den �berlebenden aber zahlen die </p><p>Utopier gewissenhaft aus, was sie versprochen haben, um sie zu �hnlichen </p><p>Wagnissen anzuspornen. Sie fragen n�mlich nicht danach, wie viele von </p><p>ihnen durch ihre Schuld ums Leben kommen, weil sie sich, wie sie meinen, </p><p>das gr��te Verdienst um die Menschheit erwerben w�rden, wenn sie den </p><p>Erdkreis von jenem Abschaum eines so greulichen und ruchlosen Volkes </p><p>gr�ndlich s�ubern k�nnten.</p><p>N�chst den Zapoleten verwenden die Utopier auch die Streitkr�fte </p><p>desjenigen Volkes, f�r das sie zu den Waffen greifen, und die </p><p>Hilfsscharen ihrer anderen Freunde; an letzter Stelle erst ziehen sie </p><p>ihre Mitb�rger heran. Aus deren Mitte nehmen sie einen Mann von </p><p>erprobter Tapferkeit und stellen ihn an die Spitze des gesamten Heeres. </p><p>Ihm ordnen sie zwei Mann unter in der Art, da� beide nur als Privatleute </p><p>gelten, solange der Oberbefehlshaber dienstf�hig ist; wird er jedoch </p><p>gefangengenommen oder f�llt er, so tritt der eine von jenen beiden </p><p>gleichsam sein Erbe an, und ihn ersetzt gegebenenfalls der andere, damit </p><p>nicht in den bunten Wechself�llen der Kriege infolge einer Gef�hrdung </p><p>des F�hrers das ganze Heer in Unordnung ger�t. In jeder Stadt hebt man </p><p>Freiwillige aus; man pre�t n�mlich niemanden wider seinen Willen zum </p><p>Kriegsdienst au�erhalb der Grenzen seiner Heimat, weil man der </p><p>�berzeugung ist, da� einer, der von Natur etwas furchtsam ist, nicht nur </p><p>selbst sich nicht tapfer zeigen, sondern auch seine Kameraden mit seiner </p><p>Angst anstecken wird. Bricht aber der Feind ins Land ein, so steckt man </p><p>die Feiglinge dieser Art im Falle k�rperlicher Tauglichkeit auf die </p><p>Schiffe unter bessere Soldaten oder verteilt sie auf die einzelnen </p><p>Festungen, von wo sie nicht ausrei�en k�nnen. Sie m�ssen sich vor ihren </p><p>Kameraden sch�men, haben den Feind unmittelbar vor sich und sehen keine </p><p>M�glichkeit zur Flucht: so vergessen sie ihre Furcht und werden oft </p><p>durch h�chste Not zu mutigen M�nnern. So wenig aber einerseits ein </p><p>Utopier wider seinen Willen zu einem ausw�rtigen Kriege fortgeschleppt </p><p>wird, so wenig hindert man anderseits die Frauen, mit ihren M�nnern ins </p><p>Feld zu ziehen; ja, man fordert sie dazu noch auf und spornt sie dazu </p><p>an, indem man sie lobt. Die Frauen, die mitausr�cken, stellt man an der </p><p>Front mit ihren M�nnern in eine Reihe; au�erdem hat ein jeder K�mpfer </p><p>seine Kinder, Verwandten und Angeh�rigen um sich, damit sich diejenigen </p><p>einander aus n�chster N�he beistehen k�nnen, die die Natur am st�rksten </p><p>zu gegenseitiger Hilfe anspornt. Die h�chste Schmach ist es f�r einen </p><p>Gatten, ohne den anderen heimzukommen, oder f�r einen Sohn, seinen Vater </p><p>zu �berleben. Infolgedessen k�mpft man, wenn es zum Handgemenge kommt </p><p>und die Feinde standhalten, in einem langen und unheilvollen Ringen bis </p><p>zur Vernichtung. Zwar suchen die Utopier mit allen Mitteln zu verh�ten, </p><p>in eigener Person k�mpfen zu m�ssen, wofern sie nur den Krieg mit Hilfe </p><p>einer Schar gemieteter Stellvertreter zu Ende bringen k�nnen; wenn es </p><p>sich jedoch nicht vermeiden l��t, da� sie selber mitk�mpfen, so nehmen </p><p>sie den Kampf ebenso unerschrocken auf, wie sie sich vorher klug </p><p>zur�ckgehalten haben, solange es m�glich war. Und beim ersten Angriff </p><p>gehen sie nicht mit wildem Ungest�m vor; vielmehr w�chst ihre St�rke </p><p>langsam und allm�hlich und je l�nger der Kampf dauert. Dabei sind sie so </p><p>unbeugsamen Sinnes, da� sie sich eher niedermetzeln als in die Flucht </p><p>schlagen lassen; denn das beruhigende Bewu�tsein, da� ein jeder daheim </p><p>zu leben hat, sowie die Befreiung von der qu�lenden Sorge um das Los </p><p>ihrer Nachkommen -- eine Besorgnis, die sonst �berall einen tapferen </p><p>Sinn l�hmt, -- machen die K�mpfer hochgemut, so da� sie den Gedanken, </p><p>sich besiegen zu lassen, als unw�rdig von sich weisen. Au�erdem fl��t </p><p>ihnen ihre milit�rische Erfahrung Zuversicht ein, und schlie�lich spornt </p><p>sie die gute Erziehung, die sie in der Schule und durch die trefflichen </p><p>Einrichtungen ihres Staates von Kind auf genossen haben, noch mehr zur </p><p>Tapferkeit an. Infolgedessen ist in ihren Augen das Leben weder so </p><p>wertlos, da� sie es blindlings vergeuden, noch so �bertrieben wertvoll, </p><p>da� sie damit geizen und sich in schimpflicher Weise daran klammern, </p><p>wenn die Ehre dazu r�t, es hinzugeben. Wenn der Kampf allerorten am </p><p>wildesten tobt, nehmen sich die auserlesensten J�nglinge, die sich dazu </p><p>verschworen und geweiht haben, den feindlichen F�hrer zum Gegner; auf </p><p>ihn dringen sie offen ein, ihn greifen sie aus dem Hinterhalt an, und </p><p>aus der Ferne wie aus der N�he gehen sie auf ihn los, und in einem</p><p>langen und l�ckenlosen Keil -- denn die wegen Erm�dung ausfallenden </p><p>K�mpfer werden best�ndig durch frische ersetzt -- st�rmen sie gegen ihn </p><p>an. Nur selten kommt es vor, da� er nicht niedergestochen wird oder da� </p><p>er nicht lebendig in die Gewalt seiner Feinde ger�t, es sei denn, da� er </p><p>sich durch die Flucht rettet. </p><p>Ist der Sieg auf seiten der Utopier, so metzeln sie nicht wild darauf </p><p>los; statt die Geschlagenen umzubringen, nehmen sie sie lieber gefangen. </p><p>Auch verfolgen sie die Fliehenden niemals so blindlings, da� sie bei </p><p>alledem nicht wenigstens noch eine geordnete und kampfbereite Schar </p><p>zur�ckbehielten. Wenn daher ihre �brigen Verb�nde geschlagen sind und </p><p>sie erst mit dem letzten den Sieg errungen haben, so lassen sie die </p><p>Feinde lieber ganz und gar entfliehen, als da� sie sich dazu </p><p>entschlie�en, die Fliehenden mit ungeordneten Verb�nden ihrer Truppen zu </p><p>verfolgen. Sie vergessen n�mlich nicht, was ihnen selbst mehr als einmal </p><p>widerfahren ist. Die Masse ihres gesamten Heeres war v�llig besiegt; die </p><p>Feinde jubelten �ber ihren Sieg und zerstreuten sich hier und da auf der </p><p>Verfolgung. Die Utopier dagegen hatten einige wenige ihrer Leute im </p><p>Hinterhalt aufgestellt, die auf g�nstige Gelegenheiten lauerten. Sie </p><p>griffen die Feinde, die vereinzelt umherschw�rmten und es in voreiliger </p><p>Sorglosigkeit an der n�tigen Vorsicht fehlen lie�en, pl�tzlich an und </p><p>ver�nderten das Ergebnis der ganzen Schlacht. Sie wanden den Feinden den </p><p>Sieg, der ihnen schon sicher war und an dem sie nicht mehr gezweifelt </p><p>hatten, aus den H�nden und besiegten als Besiegte wiederum die Sieger. </p><p>Es ist schwer zu sagen, ob die Utopier einen Hinterhalt mit gr��erer </p><p>Schlauheit zu legen oder mit gr��erer Vorsicht zu vermeiden wissen. Man </p><p>k�nnte meinen, sie tr�fen Vorbereitungen zur Flucht, wenn sie alles </p><p>andere eher im Sinne haben, und umgekehrt, wenn sie die Absicht haben zu </p><p>fliehen, k�nnte man meinen, sie d�chten an nichts weniger. F�hlen sie </p><p>sich n�mlich hinsichtlich ihrer Zahl oder Stellung zu sehr im Nachteil, </p><p>so ziehen sie bei Nacht in aller Stille ab oder t�uschen den Feind durch </p><p>irgendeine Kriegslist, oder sie gehen bei Tage so allm�hlich und in so </p><p>guter Ordnung zur�ck, da� es ebenso gef�hrlich ist, sie w�hrend des </p><p>Abr�ckens anzugreifen wie w�hrend des Anst�rmens. Ihr Lager befestigen </p><p>sie �beraus sorgf�ltig mit einem sehr tiefen und breiten Graben, wobei </p><p>sie die ausgehobene Erde nach innen werfen. Dazu verwenden sie keine </p><p>Tagel�hner, sondern die Soldaten selbst besorgen die Arbeit, und das </p><p>gesamte Heer hilft dabei mit, ausgenommen die Posten, die bewaffnet vor </p><p>dem Wall Wache halten, um pl�tzliche �berf�lle abzuwehren. Und so legen </p><p>die Utopier bei so zahlreicher Mitarbeit starke und weitausgedehnte </p><p>Befestigungen wider alles Erwarten in kurzer Zeit an. </p><p>Die Waffen, die die Utopier verwenden, sind stark genug zur Abwehr von </p><p>Angriffen, ohne jedoch jede Art von Bewegung oder Haltung zu hindern; ja </p><p>nicht einmal beim Schwimmen empfindet man sie als l�stig. Denn in voller </p><p>Ausr�stung schwimmen zu lernen, geh�rt zu den Anfangsgr�nden der </p><p>milit�rischen Ausbildung der Utopier. Im Kampf aus der Ferne benutzen </p><p>sie Pfeile, die sie mit gro�er Kraft und zugleich mit bester </p><p>Treffsicherheit abschie�en, und zwar nicht blo� zu Fu�, sondern sogar </p><p>vom Pferde aus. Im Nahkampf aber f�hren sie keine Schwerter, sondern </p><p>�xte, die durch ihre Sch�rfe oder Schwere t�dlich verwunden, je nachdem </p><p>man sie zum Hieb oder Stich verwendet. In der Erfindung von </p><p>Kriegsmaschinen beweisen die Utopier ganz besonderen Scharfsinn; die </p><p>fertigen Maschinen halten sie mit gr��ter Sorgfalt geheim, damit sie </p><p>nicht bekannt werden, ehe man sie braucht, und nicht mehr Spott und Hohn </p><p>erregen als Nutzen stiften. Bei ihrer Herstellung achtet man besonders </p><p>darauf, da� sie leicht zu fahren und bequem zu lenken sind. Einen </p><p>Waffenstillstand, den die Utopier mit dem Feind abschlie�en, halten sie</p><p>so gewissenhaft, da� sie ihn nicht einmal dann verletzen, wenn sie </p><p>gereizt werden. Im Feindesland richten sie keine Verw�stungen an; auch </p><p>brennen sie die Saaten nicht nieder. Ja, sie sorgen sogar daf�r, da� </p><p>nach M�glichkeit weder Menschen noch Pferde die Saaten zertreten, weil </p><p>sie der Ansicht sind, da� sie zu ihrem eigenen Vorteil wachsen. Einem </p><p>Wehrlosen tun sie nichts zuleide, wenn er nicht gerade ein Spion ist. </p><p>St�dte, die sich ihnen ergeben, schonen sie; aber auch solche, die sie </p><p>erst erobern m�ssen, pl�ndern sie nicht; wohl aber lassen sie diejenigen </p><p>B�rger, die die �bergabe zu verhindern gesucht haben, erw�rgen, w�hrend </p><p>sie die anderen Verteidiger zu Sklaven machen. Der gesamten Bev�lkerung, </p><p>die nicht mitgek�mpft hat, wird kein Haar gekr�mmt. Wenn die Utopier </p><p>erfahren, da� einige B�rger zur �bergabe geraten haben, so machen sie </p><p>ihnen einen Teil von dem Hab und Gut der Verurteilten zum Geschenk; den </p><p>Rest geben sie ihren Hilfstruppen: denn von ihnen selbst begehrt niemand </p><p>einen Anteil an der Beute. Nach Beendigung des Krieges aber legen sie </p><p>die Kosten nicht ihren Freunden auf, f�r die sie sie aufgewendet haben, </p><p>sondern den Besiegten und fordern auf Grund dessen zum Teil bares Geld, </p><p>das sie dann f�r �hnliche Kriegszwecke aufsparen, zum Teil Grund und </p><p>Boden, der ihnen im Lande der Besiegten dauernd geh�rt und einen nicht </p><p>geringen Ertrag bringt. </p><p>Derartige Eink�nfte haben die Utopier jetzt bei vielen V�lkern; sie sind </p><p>aus verschiedenen Ursachen im Laufe der Zeit entstanden und bis auf mehr </p><p>als 700000 Dukaten im Jahr angewachsen. Zu ihrer Erhebung entsenden sie </p><p>einige von ihren Mitb�rgern als sogenannte Qu�storen, die in dem fremden </p><p>Lande pr�chtig leben und in der Art gro�er Herren auftreten. Aber </p><p>trotzdem bleibt noch viel Geld �brig, das in die Staatskasse flie�t, </p><p>soweit es die Qu�storen nicht lieber dem betreffenden Volke leihen </p><p>wollen, was sie h�ufig so lange tun, bis sie es notwendig brauchen. Und </p><p>kaum jemals kommt es vor, da� sie den ganzen Betrag zur�ckverlangen. Von </p><p>dem erw�hnten Grund und Boden �bereignen die Utopier einen Teil </p><p>denjenigen, die sich auf ihre Veranlassung einer so gro�en Gefahr </p><p>aussetzten, wie ich sie weiter oben geschildert habe. </p><p>Greift irgendein F�rst zu den Waffen gegen die Utopier und schickt er </p><p>sich an, in ihr Gebiet einzufallen, so treten sie ihm sogleich mit </p><p>starken Kr�ften au�erhalb ihres Landes entgegen; denn weder f�hren sie </p><p>ohne Not im eigenen Lande Krieg, noch ist irgendeine Not jemals so </p><p>schlimm, da� sie die Utopier zwingen k�nnte, fremde Hilfstruppen auf </p><p>ihre Insel zu lassen. </p><p>Die Religion der Utopier </p><p>Die religi�sen Vorstellungen sind nicht nur in den einzelnen Teilen der </p><p>Insel, sondern auch in den einzelnen St�dten verschieden, indem die </p><p>einen die Sonne, die andern den Mond und wieder andere diesen oder jenen </p><p>Planeten als Gottheit anbeten. Einige verehren auch einen beliebigen </p><p>Menschen, der vor alters durch Tugend oder Ruhm gegl�nzt hat, nicht blo� </p><p>als Gott, sondern sogar als h�chsten Gott. Aber der weit gr��te und </p><p>zugleich weitaus kl�gere Teil glaubt an nichts von alledem, sondern nur </p><p>an ein einziges, unerkanntes, ewiges, unendliches und unerforschliches </p><p>g�ttliches Wesen, das �ber menschliches Begriffsverm�gen erhaben ist und </p><p>dieses ganze Weltall erf�llt, und zwar als t�tige Kraft, nicht als </p><p>k�rperliche Masse; man nennt es Vater. Ihm schreibt man Ursprung, </p><p>Wachstum, Fortschritt, Wandel und Ende aller Dinge zu, und ihm allein </p><p>erweist man g�ttliche Ehren. Mit den Anh�ngern dieser Lehre stimmen auch </p><p>alle anderen trotz aller Glaubensunterschiede in diesem einen Punkte </p><p>�berein, da� sie an _ein_ h�chstes Wesen glauben, dem die Erschaffung</p><p>der Welt und die Vorsehung zu verdanken ist, und dieses g�ttliche Wesen </p><p>nennen sie alle ohne Unterschied in ihrer heimischen Sprache Mythras. </p><p>Aber insofern sind sie verschiedener Ansicht, da� die einzelnen ihn </p><p>verschieden auffassen. Dabei glaubt aber jeder, was es auch sein m�ge, </p><p>das er pers�nlich f�r das H�chste h�lt, es sei doch durchaus dasselbe </p><p>Wesen, dessen g�ttliche Macht und Majest�t allein nach der </p><p>�bereinstimmenden �berzeugung aller V�lker der Inbegriff aller Dinge </p><p>ist. Indessen machen sie sich alle im Laufe der Zeit von der </p><p>Mannigfaltigkeit abergl�ubischer Vorstellungen frei und lassen ihre </p><p>Anschauungen zu jener einen Religion verschmelzen, die, wie es scheint, </p><p>vern�nftiger ist als die anderen. Und ohne Zweifel w�ren die �brigen </p><p>religi�sen Vorstellungen schon l�ngst nicht mehr vorhanden, wenn nicht </p><p>alles Ungemach, das jemandem bei dem Vorhaben, seine Religion zu </p><p>wechseln, zuf�llig widerf�hrt, von ihm aus Furcht als eine Schickung des </p><p>Himmels aufgefa�t w�rde, gleich als ob die Gottheit, deren Verehrung </p><p>aufgegeben werden sollte, den gottlosen und gegen sie gerichteten Plan </p><p>ahnden wolle. Nachdem die Utopier jedoch durch uns von Christi Namen, </p><p>Lehre, Art und Wundern geh�rt hatten und ebenso von der </p><p>staunenerregenden Standhaftigkeit der zahlreichen M�rtyrer, deren </p><p>freiwillig vergossenes Blut so zahlreiche V�lker weit und breit zu </p><p>Christus bekehrt hat, da nahmen auch sie mit einem kaum glaublichen </p><p>Verlangen seine Lehre an, sei es nun, weil es Gott ihnen mehr im </p><p>geheimen eingab, oder sei es, weil das Christentum, wie es schien, der </p><p>bei ihnen selbst am weitesten verbreiteten Lehre am n�chsten kam. </p><p>Gleichwohl m�chte ich auch dem Umstand nicht wenig Gewicht beimessen, </p><p>da� sie geh�rt hatten, Christus habe an der gemeinschaftlichen </p><p>Lebensweise seiner J�nger Gefallen gefunden und sie sei bei den </p><p>Zusammenk�nften der echten Christen noch heutigestags �blich. Von </p><p>welcher Bedeutung das nun auch gewesen sein mag, jedenfalls traten nicht </p><p>wenige zu unserem Glauben �ber und lie�en sich mit dem geweihten Wasser </p><p>taufen. Leider war unter uns vieren -- nur so viele waren wir noch, da </p><p>zwei gestorben waren -- kein Priester. Infolgedessen m�ssen die Utopier, </p><p>wenn sie auch im �brigen eingeweiht sind, dennoch bis heute auf den </p><p>Genu� der Sakramente verzichten, da diese bei uns nur die Priester </p><p>spenden d�rfen. Doch sind sie sich �ber deren Wert und Bedeutung klar </p><p>und haben keinen sehnlicheren Wunsch; ja, sie er�rtern bereits lebhaft </p><p>die Frage, ob nicht auch ohne Auftrag des Papstes der Christenheit einer </p><p>aus ihren Reihen gew�hlt und zum Priester ernannt werden kann. Und es </p><p>schien so, als h�tten sie die Absicht, einen zu w�hlen, aber bei meiner </p><p>Abreise war das noch nicht geschehen. </p><p>Auch die, die vom Christentum nichts wissen wollen, machen trotzdem </p><p>niemanden abspenstig und lassen jeden, der dazu �bertritt, unbehelligt. </p><p>Nur einer aus unserer Gemeinschaft wurde w�hrend meiner Anwesenheit </p><p>verhaftet. Als Neugetaufter redete er, obgleich wir ihm davon abrieten, </p><p>�ffentlich �ber die Verehrung Christi mit mehr Eifer als Klugheit. Dabei </p><p>geriet er allm�hlich so in Hitze, da� er sich bald nicht mehr damit </p><p>begn�gte, das, was nur uns heilig ist, �ber alles andere zu stellen. Er </p><p>verurteilte vielmehr ohne weiteres alle anderen Lehren, nannte sie </p><p>unheilig und bezeichnete ihre Anh�nger als ruchlose Gottesl�sterer, die </p><p>es verdienten, in die H�lle zu kommen. Wenn einer lange �ffentlich so </p><p>redet, nehmen ihn die Utopier fest und stellen ihn vor Gericht, aber </p><p>nicht wegen Religionsverletzung, sondern wegen Volksverhetzung, und, </p><p>wenn er f�r schuldig befunden wird, bestrafen sie ihn mit Verbannung; </p><p>denn unter ihre �ltesten Bestimmungen rechnen sie die, da� niemand von </p><p>seiner Religion Schaden haben darf. Utopus hatte n�mlich gleich anfangs </p><p>erfahren, da� die Eingeborenen vor seiner Ankunft best�ndig </p><p>Religionsk�mpfe miteinander gef�hrt hatten; er hatte auch beobachtet, </p><p>da� bei der allgemeinen Uneinigkeit die Sekten einzeln f�r das Vaterland</p><p>k�mpften und da� ihm dieser Umstand Gelegenheit bot, sie insgesamt zu </p><p>besiegen. Als er dann den Sieg errungen hatte, setzte er </p><p>Religionsfreiheit f�r jedermann fest und bestimmte au�erdem, wenn jemand </p><p>auch andere zu seinem Glauben bekehren wolle, so d�rfe er es nur in der </p><p>Weise betreiben, da� er seine Ansicht ruhig und bescheiden auf </p><p>Vernunftgr�nden aufbaue, die anderen aber nicht mit bitteren Worten </p><p>zerpfl�cke. Gelinge es ihm nicht, durch Zureden zu �berzeugen, so solle </p><p>er keinerlei Gewalt anwenden und sich nicht zu Schimpfworten hinrei�en </p><p>lassen. Geht aber jemand in dieser Sache zu ungest�m vor, so bestrafen </p><p>ihn die Utopier mit Verbannung oder Sklavendienst. Diese Bestimmung traf </p><p>Utopus nicht blo� im Interesse des Friedens, den, wie er sah, </p><p>best�ndiger Kampf und unvers�hnlicher Ha� von Grund aus zerst�rten, </p><p>sondern weil er der Ansicht war, damit sei auch der Religion gedient. Er </p><p>wagte es auch nicht, �ber die Religion so ohne weiteres eine </p><p>Entscheidung zu treffen, gleichsam in Ungewi�heit dar�ber, ob Gott nicht </p><p>doch einen mannigfaltigen und vielseitigen Kult haben wolle und deshalb </p><p>die einzelnen auf verschiedene Weise inspiriere. Jedenfalls hielt er es </p><p>f�r eine Anma�ung und Torheit, wenn jemand mit Gewalt und Drohungen </p><p>verlangte, da� alle seine pers�nliche Ansicht �ber die Wahrheit teilten. </p><p>Sollte aber wirklich nur einer Religion die meiste Wahrheit zukommen und </p><p>sollten alle anderen wertlos sein, so w�rde sich dann schlie�lich </p><p>einmal, das sah Utopus sicher voraus, die Macht der Wahrheit schon von </p><p>selbst Bahn brechen und sich deutlich offenbaren, wenn man ihre Sache </p><p>nur mit Vernunft und M��igung betreibe. K�mpfe man aber mit Waffen und </p><p>Aufruhr um die Religion, so werde die beste und erhabenste zwischen den </p><p>nichtigsten Wahnvorstellungen der Streitenden erstickt werden wie die </p><p>Saaten zwischen Dornen und Gestr�pp, da gerade die schlechtesten </p><p>Menschen am hartn�ckigsten seien. Daher lie� Utopus diese ganze Frage </p><p>unentschieden und stellte es einem jeden anheim, was er glauben wollte. </p><p>Nur sollte niemand, das gebot er feierlich und streng, die W�rde der </p><p>menschlichen Natur so weit vergessen, da� er annehme, die Seele gehe </p><p>zugleich mit dem K�rper zugrunde oder im Laufe der Welt walte der blinde </p><p>Zufall und nicht die g�ttliche Vorsehung. Und deshalb erwarten den </p><p>Menschen, wie die Utopier glauben, nach diesem Leben Strafen f�r seine </p><p>Missetaten und Belohnungen f�r seine Tugenden. Wer das Gegenteil </p><p>annimmt, ist in ihren Augen nicht einmal ein Mensch, weil er die </p><p>menschliche Seele in ihrer Erhabenheit in den niedrigen Zustand </p><p>tierischer K�rperlichkeit herunterdr�ckt; weit weniger noch rechnen sie </p><p>ihn zu ihren Mitb�rgern. Denn um all ihre Einrichtungen und Sitten w�rde </p><p>er sich nicht im geringsten k�mmern, wenn ihn nicht die Furcht davon </p><p>abhielte. Wer sollte n�mlich daran zweifeln, da� ein solcher Mensch </p><p>danach trachten w�rde, die Staatsgesetze seines Landes entweder im </p><p>geheimen mit List zu umgehen oder mit Gewalt zu verletzen, sofern er </p><p>dadurch seine pers�nlichen W�nsche befriedigen kann, da er ja �ber die </p><p>Gesetze hinaus nichts mehr f�rchtet und �ber den Tod hinaus nichts mehr </p><p>erhofft? Deshalb erweist man einem, der so gesinnt ist, keine Ehre und </p><p>�bertr�gt ihm auch kein �ffentliches Amt. So wird er allenthalben als </p><p>ein unbrauchbarer Mensch von niedrigem Charakter verachtet. Aber eine </p><p>wirkliche Strafe erleidet er nicht, weil es die �berzeugung der Utopier </p><p>ist, da� es nicht im Belieben des Menschen steht zu glauben, was er </p><p>will. Sie zwingen ihn auch weder mit irgendwelchen Drohungen, seine </p><p>wahre Gesinnung zu verheimlichen, noch lassen sie Heuchelei und L�gen </p><p>zu, die in ihren Augen an Betrug grenzen und ihnen deshalb �beraus </p><p>verha�t sind. Wohl aber verbieten sie ihm, seine Meinung zu verteidigen, </p><p>jedoch nur vor der gro�en Masse. Sonst n�mlich, in einem geschlossenen </p><p>Kreise von Priestern und ernsten M�nnern, lassen sie es nicht blo� zu, </p><p>sondern fordern auch noch dazu auf, weil sie zuversichtlich damit </p><p>rechnen, sein Wahnsinn werde doch noch endlich einmal der Vernunft </p><p>weichen.</p><p>Andere, und zwar gar nicht wenige, begehen den gerade entgegengesetzten </p><p>Fehler -- man macht ihnen keine Schwierigkeiten, da ihre Ansicht nicht </p><p>ganz unbegr�ndet ist und sie selbst nicht b�sartig sind -- und meinen, </p><p>auch die Tierseelen seien unsterblich, jedoch nicht vergleichbar an </p><p>W�rde mit unseren Menschenseelen und auch nicht zu gleicher </p><p>Gl�ckseligkeit geschaffen. Die Utopier sind n�mlich fast alle fest davon </p><p>�berzeugt, da� den Menschen eine unbegrenzte Gl�ckseligkeit bevorsteht. </p><p>Infolgedessen wehklagen sie stets, wenn jemand krank ist, niemals aber, </p><p>wenn jemand stirbt; sie m��ten denn gerade sehen, wie sich der Sterbende </p><p>nur mit Angst und Widerwillen vom Leben losrei�t. Das halten sie n�mlich </p><p>f�r ein ganz schlimmes Vorzeichen, gleich als ob die Seele ohne Hoffnung </p><p>und mit schlechtem Gewissen in irgendeiner dunklen Ahnung drohender </p><p>Strafe vor dem Ende zur�ckschaudere. Au�erdem wird sich nach ihrer </p><p>Meinung Gott nicht �ber die Ankunft eines Menschen freuen, der auf </p><p>seinen Ruf nicht bereitwillig herbeieilt, sondern sich nur ungern und </p><p>widerstrebend hinschleppen l��t. Vor einem solchen Sterben entsetzen </p><p>sich denn auch die, die es mit ansehen, und wer so stirbt, wird in </p><p>Trauer und aller Stille aus der Stadt getragen; dann betet man zu dem </p><p>den Seelen der Verstorbenen gn�digen Gott, er m�ge dem Heimgegangenen </p><p>seine S�nden aus Gnaden vergeben, und setzt die Leiche bei. Wer dagegen </p><p>freudig und voll Zuversicht stirbt, wird von niemandem betrauert, </p><p>sondern unter Gesang gibt man ihm das letzte Geleit und empfiehlt seine </p><p>Seele liebevoll dem gro�en Gott. Schlie�lich verbrennt man den Leichnam </p><p>mehr in Ehrfurcht als in Trauer und errichtet an Ort und Stelle eine </p><p>Denks�ule, in die die Ehrentitel des Toten eingemei�elt sind. Nach der </p><p>R�ckkehr von der Beisetzung unterh�lt man sich �ber Lebenswandel und </p><p>Taten des Heimgegangenen, und kein Abschnitt seines Lebens wird dabei </p><p>h�ufiger oder lieber besprochen als sein seliges Ende. </p><p>Dieses ehrende Gedenken rechtschaffener Menschen ist in den Augen der </p><p>Utopier f�r die Lebenden ein �beraus wirksamer Anreiz zur Tugend und </p><p>zugleich f�r die Verstorbenen eine h�chst willkommene Verehrung. Sie </p><p>denken sich n�mlich, da� die Heimgegangenen bei den Gespr�chen �ber sie </p><p>zugegen sind, wenn auch unsichtbar f�r das schwache Auge der </p><p>Sterblichen. Einerseits n�mlich w�rde es gar nicht mit ihrer </p><p>Gl�ckseligkeit vereinbar sein, wenn sie in ihrer Bewegungsfreiheit </p><p>beschr�nkt w�ren, und anderseits w�re es undankbar von ihnen, wenn sie </p><p>�berhaupt keine Sehnsucht mehr empf�nden, ihre Lieben wiederzusehen, mit </p><p>denen sie bei Lebzeiten durch gegenseitige Liebe und Hochsch�tzung </p><p>verbunden waren, Neigungen, die bei guten Menschen, so vermutet man, wie </p><p>die �brigen trefflichen Eigenschaften nach dem Tode eher noch zu- als </p><p>abnehmen. Die Utopier glauben demnach, da� die Toten unter den Lebenden </p><p>weilen als Ohren- und Augenzeugen ihrer Worte und Taten, und </p><p>infolgedessen gehen sie mit gr��erer Zuversicht an ihre Gesch�fte, </p><p>gleichsam im Vertrauen auf solchen Schutz; auch lassen sie sich durch </p><p>den Glauben an die Anwesenheit ihrer Vorfahren von geheimer Schandtat </p><p>abschrecken. </p><p>Auf Weissagungen und die sonstigen Prophezeiungen eines hohlen </p><p>Aberglaubens, die andere V�lker gewissenhaft beachten, legen die Utopier </p><p>gar keinen Wert, ja sie machen sich sogar dar�ber lustig. Wunder </p><p>dagegen, soweit sie ohne jede nat�rliche Veranlassung geschehen, </p><p>verehren sie als Taten und Zeugnisse der anwesenden Gottheit. Solche </p><p>Wunder kommen in Utopien, wie es hei�t, h�ufig vor, und in wichtigen und </p><p>zweifelhaften Fragen flehen sie bisweilen darum mit gro�er Zuversicht </p><p>und unter Veranstaltung eines gro�en Betfestes und erwirken auch ein </p><p>Wunder. </p><p>F�r eine Gott wohlgef�llige Verehrung halten die Utopier die Betrachtung </p><p>der Natur sowie das Lob, das man Gott als ihrem Sch�pfer spendet. Doch </p><p>gibt es auch Leute, und zwar keineswegs wenige, die unter Berufung auf </p><p>ihren Glauben von den Wissenschaften nichts wissen wollen, sich um </p><p>keinerlei Erkenntnis der Natur bem�hen und Mu�e �berhaupt nicht kennen: </p><p>nur durch Bet�tigung und gute Dienste, die man den Mitmenschen erweist, </p><p>erwirbt man sich nach ihrer Meinung Anspruch auf die Gl�ckseligkeit nach </p><p>dem Tode. Daher widmen sich die einen der Krankenpflege, die anderen </p><p>bessern Wege aus, reinigen Gr�ben, bringen Br�cken in Ordnung, stechen </p><p>Rasen aus, schaufeln Sand und graben Steine aus, f�llen und zers�gen </p><p>B�ume, fahren auf Zweigespannen Holz, Feldfr�chte und andere Dinge in </p><p>die St�dte und benehmen sich nicht nur in der T�tigkeit f�r die </p><p>Allgemeinheit, sondern auch in der f�r Privatleute wie Diener und sind </p><p>noch arbeitsamer als Sklaven. Denn jede m�hsame, schwierige und </p><p>schmutzige Arbeit, die es irgendwo gibt und von der Anstrengung, </p><p>Widerwille und Verzweiflung die meisten zur�ckschrecken, nehmen sie </p><p>willig und fr�hlich ganz auf sich. Den anderen verschaffen sie Mu�e, sie </p><p>selber aber arbeiten und plagen sich ohne Unterla�, ohne jedoch Dank </p><p>daf�r zu beanspruchen; auch tadeln sie die Lebensweise anderer nicht, um </p><p>ihre eigene daf�r zu r�hmen. Je mehr sich die Leute als Sklaven zeigen, </p><p>desto gr��ere Ehre erweist ihnen jedermann. Unter ihnen gibt es nun zwei </p><p>Sekten. Die eine ist die der Ledigen. Diese enthalten sich v�llig des </p><p>Geschlechtsverkehrs; auch essen sie kein Fleisch, einige sogar, ohne mit </p><p>irgendeinem Tier eine Ausnahme zu machen. Alle Freuden dieses Lebens </p><p>verwerfen sie als sch�dlich, und in der Hoffnung auf einen baldigen Tod </p><p>trachten sie leidenschaftlich danach, durch Nachtwachen und m�hselige </p><p>Arbeit nur die Freuden des k�nftigen Lebens zu erlangen. Die Anh�nger </p><p>der anderen Sekte sind nicht weniger auf Arbeit erpicht, ziehen es aber </p><p>dabei vor, zu heiraten; denn sie verschm�hen die Kr�fte nicht, die von </p><p>der Ehe ausgehen, und glauben der Natur ihren Zoll entrichten zu m�ssen </p><p>und dem Vaterlande Kinder schuldig zu sein. Jedes Vergn�gen, das sie in </p><p>keiner Beziehung von der Arbeit abh�lt, ist ihnen willkommen. Das </p><p>Fleisch vierf��iger Tiere sch�tzen sie schon aus dem Grunde, weil sie </p><p>von einer solchen Nahrung eine bessere Kr�ftigung zu jeder Arbeit </p><p>erwarten. Die Anh�nger dieser Sekte sind in den Augen der Utopier </p><p>kl�ger, die der anderen dagegen fr�mmer. Die letzteren w�rde man </p><p>auslachen, wenn sie sich bei der Bevorzugung der Ehelosigkeit und eines </p><p>beschwerlichen Lebens auf Gr�nde der Vernunft st�tzen wollten; so aber </p><p>betrachtet man sie wegen ihrer religi�sen Beweggr�nde mit Ehrfurcht und </p><p>Hochachtung. Vor nichts scheuen sie sich n�mlich �ngstlicher als vor </p><p>irgendeiner unbedachten �u�erung �ber die Religion. Derart also sind die </p><p>Leute, die die Utopier mit einem besonderen Namen in ihrer Landessprache </p><p>als �Buthresken� bezeichnen, was etwa unserem Worte �M�nche� entspricht. </p><p>Die Priester der Utopier sind au�erordentlich fromm und deshalb sehr </p><p>gering an Zahl. Es gibt n�mlich in jeder Stadt nicht mehr als dreizehn, </p><p>entsprechend der Zahl der Gottesh�user, au�er in Kriegszeiten. Dann aber </p><p>ziehen sieben von ihnen mit dem Heere ins Feld und werden in der </p><p>Zwischenzeit durch eine gleiche Anzahl ersetzt. Kommen dann die anderen </p><p>zur�ck, so nimmt jeder von ihnen wieder seine alte Stelle ein. Die </p><p>�berz�hligen treten der Reihe nach an die Stelle der mit Tod Abgehenden; </p><p>bis dahin sind sie Gehilfen des Oberpriesters, und einer wird an ihre </p><p>Spitze gestellt. Die Priester werden vom Volke gew�hlt, und zwar wie die </p><p>�brigen Beamten in geheimer Abstimmung, wodurch man Beg�nstigungen </p><p>vermeiden will; die Weihe der Gew�hlten vollzieht dann ihr eigenes </p><p>Kollegium. Die Priester leiten den Gottesdienst, besorgen die </p><p>Angelegenheiten des Kultus und sind eine Art Sittenrichter, und es gilt </p><p>als eine gro�e Schande, wenn jemand von ihnen wegen seines schlechten </p><p>Lebenswandels vorgeladen und zur Rede gestellt wird. Wenn auch die</p><p>Priester das Recht haben zu ermahnen und zu warnen, so steht doch die </p><p>Befugnis zu einer Ma�regelung und Bestrafung von �belt�tern nur dem </p><p>B�rgermeister und den �brigen Amtspersonen zu, nur da� die Priester </p><p>ihrerseits diejenigen, die sie als schlimme S�nder kennenlernen, vom </p><p>Gottesdienst ausschlie�en. Und es gibt kaum eine Strafe, die man mehr </p><p>f�rchtet; denn sie macht v�llig ehrlos und erweckt eine geheime </p><p>religi�se Furcht, die den Sinn zerr�ttet, da die so Bestraften auch </p><p>nicht hinsichtlich ihres K�rpers lange ohne Sorge sein k�nnen. Wenn sie </p><p>n�mlich die Priester nicht schnell von ihrer Reue �berzeugen, werden sie </p><p>festgenommen und vom Senat wegen Gottlosigkeit bestraft. </p><p>Der Unterricht der Kinder und Jugendlichen liegt in den H�nden der </p><p>Priester, und diese lassen sich mehr die Erziehung zu Sitte und Tugend </p><p>als die wissenschaftliche Ausbildung angelegen sein. Sie verwenden </p><p>n�mlich den gr��ten Flei� darauf, den noch zarten und empf�nglichen </p><p>Kinderherzen von Anfang an gesunde und der Erhaltung ihres Staates </p><p>dienliche Anschauungen einzupflanzen. Wenn diese erst einmal im Kinde </p><p>festsitzen, begleiten sie den Erwachsenen durchs ganze Leben und sind </p><p>von gro�em Nutzen f�r die Erhaltung des Staates; denn was einen Staat </p><p>zerfallen l��t, sind einzig und allein die Laster, die ihrerseits wieder </p><p>aus verkehrten Anschauungen entstehen. </p><p>Die Priester sind mit den erlesensten Frauen ihres Volkes verheiratet, </p><p>soweit sie nicht selbst Frauen sind; denn auch die Frauen sind vom </p><p>Priestertum nicht ausgeschlossen; aber eine Frau wird seltener gew�hlt </p><p>und auch dann nur, wenn sie verwitwet und betagt ist. Keine Beh�rde </p><p>genie�t n�mlich bei den Utopiern gr��ere Ehre, und zwar in dem Ausma�e, </p><p>da� ein Priester, der sich etwas hat zuschulden kommen lassen, keinem </p><p>�ffentlichen Gericht untersteht: Gott allein und sich selbst ist er </p><p>�berlassen. Die Utopier halten es n�mlich f�r S�nde, den mit </p><p>Menschenhand zu ber�hren, und w�re er auch ein noch so schlimmer </p><p>Verbrecher, der Gott auf eine so einzigartige Weise gleichsam als Opfer </p><p>geweiht ist. Diesen Brauch k�nnen sie leichter einhalten, weil ihre </p><p>Priester so gering an Zahl sind und mit so gro�er Sorgfalt ausgew�hlt </p><p>werden. Kommt es doch nur selten vor, da� ein Mann, der, aus der Zahl </p><p>der Guten als Bester ausgesucht, allein wegen seiner T�chtigkeit zu so </p><p>hoher W�rde erhoben wird, zu Verderbtheit und Lasterhaftigkeit entartet. </p><p>Sollte es aber bei der Unbest�ndigkeit der menschlichen Natur immerhin </p><p>einmal vorkommen, so braucht man davon f�r die Allgemeinheit durchaus </p><p>keinen Schaden von gro�er Bedeutung zu bef�rchten, da die Zahl der </p><p>Priester nur gering ist und sie au�er ihrem Ansehen keinerlei Macht </p><p>besitzen. Die Utopier beschr�nken aber die Zahl ihrer Priester deshalb </p><p>so stark, weil das Ansehen des Standes, dem sie jetzt so gro�e Verehrung </p><p>erweisen, nicht dadurch an Bedeutung verlieren soll, da� sie seine Ehre </p><p>vielen zuteil werden lassen, zumal da sie es f�r schwierig halten, viele </p><p>Leute zu finden, die tugendhaft genug zur Bekleidung eines Amtes sind, </p><p>f�r dessen W�rde eine nur mittelm��ige Tugendhaftigkeit nicht ausreicht. </p><p>Die Wertsch�tzung der Priester ist bei den ausw�rtigen V�lkern nicht </p><p>geringer als bei ihren Landsleuten. Das geht deutlich aus einem Brauche </p><p>hervor, den ich auch f�r den Ursprung dieser Wertsch�tzung halte. </p><p>W�hrend n�mlich die Truppen in der Schlacht um die Entscheidung k�mpfen, </p><p>halten sich die Priester abseits, aber nicht weit entfernt, und liegen </p><p>in ihren geweihten Gew�ndern auf den Knien. Die H�nde zum Himmel </p><p>erhoben, beten sie zu allererst um Frieden, sodann um Sieg f�r ihr Volk, </p><p>aber um einen Sieg, der f�r beide Teile nicht blutig ist. Im Falle des </p><p>Sieges ihres Volkes eilen sie in den Kampf und gebieten dem W�ten gegen </p><p>die Geschlagenen Einhalt. Wer sie nur sieht und anruft, wenn sie da </p><p>sind, sichert sich sein Leben; wer ihre wallenden Gew�nder ber�hrt,</p><p>sch�tzt auch, was ihm sonst noch geh�rt, vor jeder kriegerischen </p><p>Gewalttat. Infolgedessen genie�en die Priester bei allen V�lkern ringsum </p><p>eine so gro�e Verehrung und so viel wirklich majest�tisches Ansehen, da� </p><p>die Schonung, die sie vom Feinde f�r ihre Mitb�rger erwirkten, oft nicht </p><p>geringer war als die, die sie bei diesen f�r den Feind erreicht hatten. </p><p>So viel steht jedenfalls fest: schon manchmal, wenn die Front ihrer </p><p>Landsleute ins Wanken geraten war, wenn diese in ihrer verzweifelten </p><p>Lage zu fliehen begannen und der Feind zu Gemetzel und Pl�nderung </p><p>heranst�rmte, traten die Priester dazwischen, unterbrachen das </p><p>Blutvergie�en, trennten die Truppen voneinander, brachten unter </p><p>gerechten Bedingungen einen Frieden zustande und schlossen ihn ab. Denn </p><p>noch niemals ist ein Volk so wild, so grausam und so barbarisch gewesen, </p><p>da� es ihre Person nicht f�r heilig und unverletzlich gehalten h�tte. </p><p>Als Festtage begehen die Utopier den ersten und letzten Tag eines jeden </p><p>Monats und Jahres. Dieses teilen sie in Monate ein, die der Umlauf des </p><p>Mondes abgrenzt, wie der Kreislauf der Sonne das Jahr rundet. Alle </p><p>Anfangstage hei�en auf utopisch �Cynemerner� und die Schlu�tage </p><p>�Trapemerner�, was etwa soviel wie Anfangs- und Schlu�feste bedeutet. </p><p>Man sieht in Utopien prachtvolle Tempel, die nicht blo� mit gro�er Kunst </p><p>gebaut sind, sondern auch eine gewaltige Menschenmenge fassen, was ja </p><p>bei ihrer geringen Anzahl auch unbedingt notwendig ist. Gleichwohl sind </p><p>sie alle halbdunkel, und zwar soll das nicht auf mangelhafte Kenntnis in </p><p>der Baukunst zur�ckgehen, sondern auf einen Rat der Priester. Nach deren </p><p>Meinung n�mlich lenkt zuviel Licht die Gedanken ab, sparsameres und </p><p>gleichsam unsicheres Licht dagegen tr�gt zur Sammlung des Geistes und </p><p>zur Vertiefung der Andacht bei. Zwar ist in Utopien die Religion nicht </p><p>�berall die gleiche, aber all ihre, wenn auch verschiedenen und </p><p>vielf�ltigen Formen kommen trotz Verschiedenheit der Wege in einem </p><p>einheitlichen Ziele zusammen, in der Verehrung eines g�ttlichen Wesens. </p><p>Infolgedessen ist in den Tempeln nichts zu sehen oder zu h�ren, was </p><p>nicht f�r alle Religionsformen ohne Unterschied passend erschiene. Einen </p><p>seiner Sekte etwa eigent�mlichen Brauch vollzieht ein jeder innerhalb </p><p>seiner vier W�nde; den �ffentlichen Kult dagegen f�hrt man in einer Form </p><p>durch, die keiner Religion etwas von ihren Besonderheiten nimmt. Daher </p><p>ist auch kein G�tterbild im Tempel zu sehen, so da� es jedem freisteht, </p><p>unter welcher Gestalt er sich die Gottheit seinem pers�nlichen Glauben </p><p>gem�� vorstellen will. Sie rufen Gott unter keinem besonderen Namen an, </p><p>sondern nur als Mythras, ein Wort, mit dem sie alle �bereinstimmend das </p><p>eine Wesen g�ttlicher Majest�t bezeichnen, welcher Art es auch sein mag. </p><p>Die Gebete, die in Utopien abgefa�t werden, sind auch alle derart, da� </p><p>sich jeder ihrer bedienen kann, ohne gegen seinen pers�nlichen Glauben </p><p>zu versto�en. </p><p>Im Tempel kommen die Utopier an den Schlu�festtagen abends zusammen, </p><p>ohne noch etwas zu sich genommen zu haben, um Gott f�r den Segen zu </p><p>danken, den er in dem Jahre oder Monat, dessen letzter Tag dieser </p><p>Festtag ist, gespendet hat. In der Fr�he des n�chsten Tages -- denn das </p><p>ist dann ein Anfangsfesttag -- str�mt das Volk in den Tempeln zusammen, </p><p>um f�r das folgende Jahr oder den folgenden Monat, den sie mit dieser </p><p>Feier beginnen wollen, Gl�ck und Segen zu erbitten. Ehe man aber an den </p><p>Schlu�festtagen in den Tempel geht, werfen sich daheim die Frauen ihren </p><p>M�nnern und die Kinder ihren Eltern zu F��en und bekennen ihnen ihre </p><p>Verfehlungen, mag es sich nun um eine Missetat oder um eine mangelhafte </p><p>Pflichterf�llung handeln, und bitten um Vergebung ihrer Schuld. So wird </p><p>jedes W�lkchen h�uslicher Zwietracht, das etwa aufsteigt, durch solche </p><p>Abbitte verscheucht, und man nimmt reinen Herzens und unbeschwerten </p><p>Sinnes am Gottesdienst teil. Man scheut sich n�mlich, mit verst�rtem</p><p>Sinn dem Gottesdienst beizuwohnen. Ist man sich deshalb bewu�t, Ha� oder </p><p>Zorn gegen jemand zu hegen, so geht man erst dann wieder zum </p><p>Gottesdienst, wenn man sich vers�hnt und von den Leidenschaften </p><p>gereinigt hat, weil man sonst eine schnelle und schwere Strafe </p><p>f�rchtet. Im Tempel angekommen, gehen die M�nner auf die rechte und die </p><p>Frauen gesondert auf die linke Seite. Dann nehmen sie in der Weise </p><p>Platz, da� die m�nnlichen Mitglieder eines jeden Hauses vor dem </p><p>Familienvater sitzen, die Familienmutter aber die Reihe der weiblichen </p><p>Mitglieder schlie�t. Auf diese Weise k�nnen s�mtliche Bewegungen aller </p><p>Hausgenossen au�erhalb des Hauses von denen beobachtet werden, deren </p><p>Autorit�t und Zucht sie auch innerhalb des Hauses unterstehen. Ja, die </p><p>Utopier sehen auch gewissenhaft darauf, da� im Tempel immer ein J�ngerer </p><p>mit einem �lteren zusammensitzt, damit nicht die Kinder sich selbst </p><p>�berlassen bleiben und sich nicht w�hrend des Gottesdienstes kindisch </p><p>und albern benehmen. Denn gerade in dieser Zeit sollten sie es lernen, </p><p>fromme Scheu vor den Himmlischen zu hegen, die ja der st�rkste und </p><p>beinahe der einzige Ansporn zur Tugend ist. Wenn die Utopier opfern, so </p><p>schlachten sie kein Tier, und sie k�nnen nicht glauben, da� sich Gott in </p><p>seiner G�te �ber Blutvergie�en und Morden freut; hat er doch den </p><p>Lebewesen das Leben zu dem Zwecke geschenkt, da� sie leben. Sie </p><p>verbrennen Weihrauch und ebenso anderes R�ucherwerk; auch stecken sie </p><p>zahlreiche Wachskerzen auf, nicht als ob sie nicht w��ten, da� das Wesen </p><p>Gottes dieser Dinge nicht bedarf, ebensowenig wie ja auch der Gebete der </p><p>Menschen, aber sie finden Gefallen an dieser harmlosen Art </p><p>Gottesverehrung, und die Menschen f�hlen, da� diese D�fte, Lichter und </p><p>sonstigen Feierlichkeiten sie irgendwie innerlich aufrichten und zur </p><p>Verehrung Gottes freudiger stimmen. Im Tempel tr�gt das Volk wei�e </p><p>Gew�nder, der Priester dagegen buntfarbige, die nach Arbeit und Form </p><p>Bewunderung verdienen; nur ist der Stoff nicht ebenso wertvoll. Die </p><p>Gew�nder sind n�mlich nicht mit Gold gestickt oder mit seltenen Steinen </p><p>besetzt, sondern aus einzelnen Vogelfedern so geschickt und kunstvoll </p><p>gearbeitet, da� auch der kostbarste Stoff dieser Arbeit an Wert nicht </p><p>gleichkommen w�rde. Wie es au�erdem hei�t, sind in jenen Schwung- und </p><p>Flaumfedern sowie in ihrer bestimmten Anordnung, durch die sie auf dem </p><p>Priestergewande unterschieden werden, gewisse geheime Mysterien </p><p>verborgen. Ihre Auslegung ist den Priestern bekannt und wird von ihnen </p><p>gewissenhaft weiter �berliefert; die Menschen sollen dadurch an die </p><p>Wohltaten erinnert werden, die ihnen Gott erweist, an den Dank, den sie </p><p>ihm daf�r schulden, und an die Pflichten, die sie gegenseitig zu </p><p>erf�llen haben. </p><p>Sobald sich der Priester in diesem Ornat vor dem Allerheiligsten zeigt, </p><p>werfen sich alle sofort voll Ehrfurcht zu Boden unter so allgemeinem und </p><p>tiefen Schweigen, da� schon der blo�e Anblick dieses Vorgangs eine Art </p><p>Schauer einfl��t, als wenn eine Gottheit zugegen w�re. Sie bleiben eine </p><p>Weile liegen und erheben sich erst, wenn ihnen der Priester ein Zeichen </p><p>gibt. Dann singen sie Gott zu Ehren Hymnen, wozu sie zwischendurch auf </p><p>Musikinstrumenten spielen. Diese haben zu einem gro�en Teile eine andere </p><p>Gestalt als die, die man in unserem Erdteil zu sehen bekommt. Die </p><p>meisten von ihnen �bertreffen zwar die bei uns gebr�uchlichen wesentlich </p><p>an Wohlklang, doch sind einige mit den unsrigen nicht einmal zu </p><p>vergleichen. In einer Beziehung jedoch sind uns die Utopier </p><p>unzweifelhaft weit voraus, darin n�mlich, da� all ihre Musik, und zwar </p><p>die Instrumentalmusik ebenso wie die Vokalmusik, die nat�rlichen </p><p>Seelenzust�nde deutlich nachahmt und widerspiegelt, da� der Klang sich </p><p>dem Inhalt des Musikst�ckes treffend anpa�t, mag es sich um Worte eines </p><p>Betenden oder um den Ausdruck der Freude, der Sanftmut, der Aufregung, </p><p>der Trauer oder des Zornes handeln, und da� die Art der Melodie den Sinn </p><p>eines jeden Textes so lebendig veranschaulicht, da� sie die Herzen der</p><p>Zuh�rer in wunderbarer Weise ergreift, ersch�ttert und entflammt. </p><p>Zuletzt sprechen Priester und Volk zusammen feierliche Gebete in </p><p>bestimmten Fassungen, die so gehalten sind, da� jeder einzelne auf sich </p><p>beziehen kann, was alle zusammen hersagen. In diesen Gebeten ruft sich </p><p>jeder Gott als den Sch�pfer und Lenker des Weltalls und als den Geber </p><p>all der anderen G�ter wieder ins Ged�chtnis, dankt ihm f�r die zahllosen </p><p>Wohltaten, die er empfangen hat, besonders aber daf�r, da� ihn Gottes </p><p>G�te und Gnade im gl�cklichsten Staat leben und an einer Religion </p><p>teilnehmen l��t, die, wie er hofft, der Wahrheit am n�chsten kommt. </p><p>Sollte er sich darin irren oder sollte es einen besseren Staat oder eine </p><p>bessere Religion geben, die auch Gott genehmer w�re, so bitte er darum, </p><p>seine G�te m�ge es ihn erkennen lassen; er wolle ihm bereitwillig </p><p>folgen, wohin er ihn auch f�hre. Sollte aber diese Staatsform die beste </p><p>und seine Religionsauffassung die richtigste sein, so m�ge ihm Gott </p><p>Best�ndigkeit verleihen und die anderen Menschen alle zu denselben </p><p>Lebensgrunds�tzen und zu derselben Vorstellung von Gott bekehren, falls </p><p>er nicht in seinem unerforschlichen Willen auch an dieser </p><p>Mannigfaltigkeit der Bekenntnisse Gefallen finde. Endlich bittet er noch </p><p>darum, Gott m�ge ihn nach einem leichten Tode in sein Reich aufnehmen; </p><p>wie bald oder wie sp�t, das wage er nicht im voraus zu bestimmen. </p><p>Immerhin werde es ihm, soweit es ohne Verletzung der g�ttlichen Majest�t </p><p>m�glich sei, viel lieber sein, auch den schwersten Tod zu erleiden, um </p><p>eher zu Gott zu kommen, als durch das gl�cklichste Leben l�nger von ihm </p><p>ferngehalten zu werden. Nach diesem Gebet werfen sich alle abermals zu </p><p>Boden und erheben sich bald darauf wieder, um zum Essen zu gehen; den </p><p>Rest des Tages verbringen sie mit Spielen und milit�rischer Ausbildung. </p><p> * * * * *</p><p>Ich habe euch so wahrheitsgem�� wie m�glich die Form dieses Staates </p><p>beschrieben, den ich bestimmt nicht nur f�r den besten, sondern auch f�r </p><p>den einzigen halte, der mit vollem Recht die Bezeichnung �Gemeinwesen� </p><p>f�r sich beanspruchen darf. Wenn man n�mlich anderswo von Gemeinwohl </p><p>spricht, hat man �berall nur sein pers�nliches Wohl im Auge; hier, in </p><p>Utopien, dagegen, wo es kein Privateigentum gibt, k�mmert man sich </p><p>ernstlich nur um das Interesse der Allgemeinheit, und beide Male </p><p>geschieht es mit Fug und Recht. Denn wie wenige in anderen L�ndern </p><p>wissen nicht, da� sie trotz noch so gro�er Bl�te ihres Staates Hungers </p><p>sterben w�rden, wenn sie nicht auf einen Sondernutzen bedacht w�ren! Und </p><p>deshalb zwingt sie die Not, eher an sich als an ihr Volk, das hei�t an </p><p>andere, zu denken. Dagegen hier, in Utopien, wo alles allen geh�rt, ist </p><p>jeder ohne Zweifel fest davon �berzeugt, da� niemand etwas f�r seinen </p><p>Privatbedarf vermissen wird, wofern nur daf�r gesorgt wird, da� die </p><p>staatlichen Speicher gef�llt sind. Denn hier werden die G�ter reichlich </p><p>verteilt, und es gibt keine Armen und keine Bettler, und obgleich </p><p>niemand etwas besitzt, sind doch alle reich. K�nnte es n�mlich einen </p><p>gr��eren Reichtum geben, als v�llig frei von jeder Sorge, heiteren </p><p>Sinnes und ruhigen Herzens zu leben, nicht um seinen eigenen </p><p>Lebensunterhalt �ngstlich besorgt, nicht gequ�lt von der Geldforderung </p><p>der jammernden Gattin, ohne Furcht, der Sohn k�nne in Not geraten, ohne </p><p>Angst und Bange um die Mitgift der Tochter, sondern unbesorgt um den </p><p>eigenen Lebensunterhalt und um den der Seinen, der Gattin, der S�hne, </p><p>der Enkel, Urenkel und Ururenkel und der ganzen Reihe von Nachkommen, so </p><p>lang, wie sie ein Ehrenmann erwartet? Ja, diese F�rsorge erstreckt sich </p><p>sogar in demselben Umfange auf die, die fr�her gearbeitet haben, jetzt </p><p>aber nicht mehr dazu imstande sind, wie auf die, die jetzt noch </p><p>arbeiten. Da w�nschte ich, es wagte jemand, mit dieser Billigkeit die </p><p>Gerechtigkeit anderer V�lker zu vergleichen, und ich will des Todes </p><p>sein, wenn ich bei ihnen auch nur die geringste Spur von Gerechtigkeit</p><p>und Billigkeit finde! Oder ist das etwa Gerechtigkeit, wenn jeder </p><p>beliebige Edelmann oder Goldschmied oder Wucherer oder schlie�lich </p><p>irgendein anderer von denen, die entweder �berhaupt nichts tun oder </p><p>deren T�tigkeit f�r den Staat nicht dringend notwendig ist, ein </p><p>pr�chtiges und gl�nzendes Leben f�hren darf auf Grund eines Verdienstes, </p><p>den ihm sein Nichtstun oder seine �berfl�ssige T�tigkeit einbringt, </p><p>w�hrend zu gleicher Zeit der Tagel�hner, der Fuhrmann, der Schmied und </p><p>der Bauer mit seiner harten und ununterbrochenen Arbeit, wie sie kaum </p><p>ein Zugtier aushalten w�rde, die aber so unentbehrlich ist, da� ohne sie </p><p>kein Gemeinwesen auch nicht ein Jahr blo� auskommen k�nnte, einen nur so </p><p>geringen Lebensunterhalt verdient und ein so elendes Leben f�hrt, da� </p><p>einem die Lage der Zugochsen weit besser vorkommen k�nnte, weil sie </p><p>nicht so dauernd arbeiten m�ssen, weil ihre Nahrung nicht viel </p><p>schlechter ist und ihnen sogar besser schmeckt und weil sie bei alledem </p><p>wegen der Zukunft keine Angst zu haben brauchen? Aber diese Menschen </p><p>qu�lt eine erfolglose und undankbare Arbeit in der Gegenwart, auch </p><p>peinigt sie der Gedanke an ein hilfloses Alter. Denn wenn ihr t�glicher </p><p>Verdienst zu k�rglich ist, um auch nur f�r denselben Tag auszureichen, </p><p>kann auf keinen Fall etwas herausspringen und �brigbleiben, um t�glich </p><p>f�r die Verwendung im Alter zur�ckgelegt zu werden. Ist das nicht eine </p><p>ungerechte und undankbare Gemeinschaft, die den sogenannten Edelleuten, </p><p>den Goldschmieden und den �brigen Leuten dieser Art, die weiter nichts </p><p>als M��igg�nger oder Schmarotzer sind und nur unn�tze Luxusdinge </p><p>herstellen, in so verschwenderischer Weise ihre Gunst bezeugt, die </p><p>dagegen f�r die Bauern, K�hler, Tagel�hner, Fuhrleute und Schmiede, ohne </p><p>die �berhaupt kein Staat bestehen k�nnte, in keinerlei Weise sorgt? Sie </p><p>nutzt die Arbeitskraft ihrer besten Lebensjahre aus und vergilt ihnen </p><p>dann, wenn sie schlie�lich, von Alter und Krankheit beschwert, an allem </p><p>Mangel leiden, auf h�chst undankbare Weise, indem sie sie, uneingedenk </p><p>so vieler N�chte, die sie durchwacht, und so vieler und wichtiger </p><p>Dienste, die sie geleistet haben, auf ganz elende Weise sterben l��t. </p><p>Was soll man gar noch dazu sagen, da� die Reichen Tag f�r Tag von dem </p><p>t�glichen Verdienst der Armen nicht nur durch privaten Betrug, sondern </p><p>sogar auf Grund staatlicher Gesetze etwas abzwacken? So haben diese </p><p>Menschen das, was fr�her als ungerecht galt: die h�chsten Verdienste um </p><p>den Staat mit dem schn�desten Undank zu lohnen, in seiner Geltung </p><p>entstellt und sogar noch in Gerechtigkeit verwandelt, indem sie es durch </p><p>Gesetze sanktionierten. Wenn ich daher alle unsere Staaten, die heute </p><p>irgendwo in Bl�te stehen, im Geiste betrachte und �ber sie nachdenke, so </p><p>sto�e ich, so wahr mir Gott helfe, einzig und allein auf eine Art </p><p>Verschw�rung der Reichen, die unter Mi�brauch des Namens- und </p><p>Rechtstitels eines Staates nur auf ihre pers�nlichen Interessen bedacht </p><p>sind. Sie ersinnen und denken sich alle m�glichen Mittel und R�nke aus, </p><p>zun�chst, um ihren unrechtm��ig erworbenen Besitz zu behalten, ohne </p><p>f�rchten zu m�ssen, ihn zu verlieren, und sodann, um sich die </p><p>angestrengte Arbeit aller Armen so billig wie m�glich zu erkaufen und zu </p><p>ihrem Vorteil zu mi�brauchen. Sobald nun die Reichen erst einmal im </p><p>Namen des Staates, also auch im Namen der Armen, beschlossen haben, </p><p>diese Machenschaften durchzuf�hren, erhalten sie sofort Gesetzeskraft. </p><p>Aber selbst wenn diese so schlechten Menschen alle diese G�ter, die f�r </p><p>alle gereicht h�tten, in uners�ttlicher Habgier untereinander aufteilen, </p><p>wieviel fehlt ihnen trotzdem noch an dem Gl�ck des utopischen Staates! </p><p>Hier ist mit dem Gebrauch des Geldes selbst zugleich jede Geldgier aus </p><p>der Welt geschafft. Welch schwere Last von Verdrie�lichkeiten ist </p><p>dadurch abgew�lzt, welch reiche Saat von Verbrechen mitsamt der Wurzel </p><p>ausgerissen! Wer wei� n�mlich nicht, da� Betrug, Diebstahl, Raub, </p><p>Streit, Unruhe, Zank, Aufstand, Mord, Verrat und Giftmischerei, die </p><p>jetzt durch t�gliche Bestrafungen mehr geahndet als eingeschr�nkt </p><p>werden, mit der Beseitigung des Geldes absterben m�ssen und da� au�erdem</p><p>Furcht, Unruhe, Sorgen, Anstrengungen und durchwachte N�chte in </p><p>demselben Augenblick wie das Geld verschwinden werden? Ja, die Armut </p><p>selbst, der einzige Zustand, wie es scheint, in dem Geld gebraucht wird, </p><p>w�rde augenblicklich abnehmen, wenn man das Geld �berall v�llig </p><p>abschaffte. Wenn du dir das noch deutlicher machen willst, mu�t du dir </p><p>einmal ein d�rres und unfruchtbares Jahr vorstellen, in dem der Hunger </p><p>viele Tausende von Menschen dahingerafft hat. Nun behaupte ich ganz </p><p>bestimmt: h�tte man am Ende dieser Hungersnot die Speicher der Reichen </p><p>durchsucht, so w�re so viel Getreide zu finden gewesen, da� �berhaupt </p><p>niemand jene Ungunst des Wetters und jenen geringen Ertrag des Bodens </p><p>h�tte zu sp�ren brauchen, wenn man die Vorr�te unter die verteilt h�tte, </p><p>die in der Tat Opfer der Abmagerung und Auszehrung geworden sind. So </p><p>leicht k�nnte man beschaffen, was man zum Leben braucht, wenn nicht </p><p>jenes herrliche Geld, ganz offenbar dazu erfunden, den Zugang zum </p><p>Lebensunterhalt zu erschlie�en, allein es w�re, das ihn uns verschlie�t. </p><p>Das merken ohne Zweifel auch die Reichen, und sie wissen ganz genau, </p><p>wieviel besser jener Zustand w�re, nichts Notwendiges zu entbehren als </p><p>an vielerlei �berfl�ssigem �berflu� zu haben, und wieviel besser es </p><p>w�re, von so zahlreichen �beln befreit als von so gro�em Reichtum </p><p>beschwert zu sein. Ich mag auch gar nicht daran zweifeln, da� die Sorge </p><p>f�r das pers�nliche Wohl jedes einzelnen oder die Autorit�t Christi, </p><p>unseres Heilands, der bei seiner so gro�en Weisheit wissen mu�te, was </p><p>das Beste sei, und bei seiner so gro�en G�te nur zu dem raten konnte, </p><p>was er als das Beste erkannt hatte, die ganze Welt ohne M�he schon </p><p>l�ngst f�r die Gesetze des utopischen Staates gewonnen h�tte, wenn nicht </p><p>eine einzige Bestie, das Haupt und der Ursprung alles Unheils, die </p><p>Hoffart, dagegen ank�mpfte. Sie mi�t ihr Gl�ck nicht am eigenen Nutzen, </p><p>sondern am fremden Ungl�ck. Sie m�chte nicht einmal G�ttin werden, wenn </p><p>dann keine Ungl�cklichen mehr �brigblieben, �ber die sie herrschen und </p><p>die sie verh�hnen k�nnte, im Vergleich zu deren Elend ihr eigenes Gl�ck </p><p>in besonderem Glanze erstrahlen soll und die sie in ihrer Not durch </p><p>Entfaltung ihres eigenen Reichtums qu�len und aufbringen m�chte. Die </p><p>Hoffart, eine Schlange der H�lle, nistet sich in die Herzen der Menschen </p><p>ein, h�lt sie wie ein Hemmschuh zur�ck und hindert sie, einen besseren </p><p>Lebensweg einzuschlagen. Dieses Gew�rm hat sich zu tief ins Menschenherz </p><p>eingefressen, als da� es sich ohne M�he wieder herausrei�en lie�e. Und </p><p>deshalb freue ich mich, da� wenigstens den Utopiern diese Staatsform </p><p>zuteil geworden ist, die ich von Herzen gern �berall sehen m�chte. Sie </p><p>haben sich Lebenseinrichtungen geschaffen, mit denen sie das Fundament </p><p>eines Staates legten, dem nicht nur das h�chste Gl�ck, sondern, nach </p><p>menschlicher Voraussicht wenigstens, auch ewige Dauer beschieden ist. </p><p>Seitdem sie n�mlich im Inneren Ehrgeiz und Parteisucht ebenso wie die </p><p>anderen Laster mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben, droht keine </p><p>Gefahr mehr, da� sie unter innerem Zwist zu leiden haben, der schon </p><p>vielfach die alleinige Ursache des Unterganges von St�dten gewesen ist, </p><p>deren Macht und Wohlstand trefflich gesichert war. Solange jedoch die </p><p>Eintracht im Inneren und die gesunde Verfassung erhalten bleiben, ist </p><p>der Neid auch aller benachbarten F�rsten nicht imstande, das Reich zu </p><p>zerr�tten oder zu ersch�ttern, was er vor langer Zeit zwar schon zu </p><p>wiederholten Malen, aber immer ohne Erfolg versucht hat.� </p><p>Als Raphael mit seinem Bericht zu Ende war, fiel mir gar mancherlei ein, </p><p>was mir an den Sitten und Gesetzen jenes Volkes �beraus sonderbar </p><p>vorkam, nicht nur an der Art und Weise seiner Kriegf�hrung, an seinem </p><p>Gottesdienst und seiner Religion und an noch anderen seiner </p><p>Einrichtungen, sondern auch ganz besonders an dem eigentlichen Fundament </p><p>seiner ganzen Verfassung, n�mlich an seinem gemeinschaftlichen Leben und </p><p>der gemeinschaftlichen Beschaffung des Lebensunterhalts, und zwar unter </p><p>Ausschaltung jedes Geldverkehrs. Beseitigt doch schon diese letzte</p><p>Bestimmung f�r sich allein von Grund aus jeden Adel, jede Pracht, jeden </p><p>Glanz, jede W�rde, also den der �ffentlichen Meinung nach wahren Glanz </p><p>und Schmuck eines Staates. Ich wu�te jedoch, da� Raphael vom Erz�hlen </p><p>m�de war, und ich war nicht ganz sicher, ob er einen Widerspruch gegen </p><p>seine Meinung vertragen w�rde, zumal da ich daran dachte, wie er gewisse </p><p>Leute deshalb getadelt hatte, weil sie nach seiner Ansicht Angst </p><p>hatten, nicht f�r klug genug zu gelten, wenn sie nicht an den Einf�llen </p><p>anderer Leute etwas f�nden, woran sie herumzausen k�nnten. Deshalb lobte </p><p>ich nur die Verfassung jenes Volkes und die Erz�hlung Raphaels, nahm ihn </p><p>bei der Hand und f�hrte ihn ins Haus zum Essen; doch sagte ich vorher </p><p>noch, wir w�rden wohl noch ein anderes Mal Zeit finden, �ber die </p><p>gleichen Dinge tiefer nachzudenken und uns ausf�hrlicher mit ihm zu </p><p>unterhalten. Ich wollte nur, es k�me noch einmal dazu! Bis dahin kann </p><p>ich zwar nicht allem zustimmen, was dieser �brigens unbestritten </p><p>hochgelehrte Mann von reifer Lebenserfahrung gesagt hat, doch gestehe </p><p>ich ohne weiteres, da� ich sehr vieles von der Verfassung der Utopier in </p><p>unseren Staaten eingef�hrt sehen m�chte. Allerdings mu� ich das wohl </p><p>mehr w�nschen, als da� ich es hoffen d�rfte. </p><p>Ende. </p><p>Ende der Nachmittagserz�hlung des Raphael Hythlodeus �ber die Gesetze </p><p>und Einrichtungen der bisher nur wenigen bekannten Insel Utopia, durch </p><p>den hochber�hmten und hochgelehrten Herrn Thomas Morus, B�rger und </p><p>Vicecomes von London, bekanntgegeben. </p><p>[ Im folgenden werden alle ge�nderten Textzeilen angef�hrt, wobei </p><p> jeweils zuerst die Zeile wie im Original, danach die ge�nderte Zeile</p><p> steht.</p><p>unserer Welt gegeh�rt -- sie nennen uns Ultra�quinoktialen�--, au�er da� </p><p>unserer Welt geh�rt -- sie nennen uns Ultra�quinoktialen�--, au�er da� </p><p>regiert zu werden, wie sich ja auch niemand gern mit einem anderen in </p><p>regiert zu werden, wie sich ja auch niemand gern mit einem anderen </p><p>Qual sei, und sich in Zuversicht und gutes Mutes von diesem traurigen </p><p>Qual sei, und sich in Zuversicht und guten Mutes von diesem traurigen </p><p>] </p><p>End of the Project Gutenberg EBook of Utopia, by Thomas Morus </p><p>*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK UTOPIA *** </p><p>***** This file should be named 26971-8.txt or 26971-8.zip ***** </p><p>This and all associated files of various formats will be found in: </p><p> http://www.gutenberg.org/2/6/9/7/26971/</p><p>Produced by Norbert H. Langkau, Jana Srna and the Online </p><p>Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net </p><p>Updated editions will replace the previous one--the old editions </p><p>will be renamed.</p><p>Creating the works from public domain print editions means that no </p><p>one owns a United States copyright in these works, so the Foundation </p><p>(and you!) can copy and distribute it in the United States without </p><p>permission and without paying copyright royalties. Special rules,</p><p>set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to </p><p>copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to </p><p>protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project</p><p>Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you </p><p>charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you</p><p>do not charge anything for copies of this eBook, complying with the </p><p>rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose</p><p>such as creation of derivative works, reports, performances and </p><p>research. They may be modified and printed and given away--you may do</p><p>practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is</p><p>subject to the trademark license, especially commercial </p><p>redistribution. </p><p>*** START: FULL LICENSE *** </p><p>THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE </p><p>PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK </p><p>To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free </p><p>distribution of electronic works, by using or distributing this work </p><p>(or any other work associated in any way with the phrase "Project </p><p>Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project </p><p>Gutenberg-tm License (available with this file or online at </p><p>http://gutenberg.net/license). </p><p>Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm</p><p>electronic works </p><p>1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm</p><p>electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to </p><p>and accept all the terms of this license and intellectual property </p><p>(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all</p><p>the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy </p><p>all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession. </p><p>If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project </p><p>Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the </p><p>terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or </p><p>entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. </p><p>1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be</p><p>used on or associated in any way with an electronic work by people who </p><p>agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few</p><p>things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works </p><p>even without complying with the full terms of this agreement. See</p><p>paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project</p><p>Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement </p><p>and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic </p><p>works. See paragraph 1.E below.</p><p>1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"</p><p>or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project</p><p>Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the</p><p>collection are in the public domain in the United States. If an</p><p>individual work is in the public domain in the United States and you are </p><p>located in the United States, we do not claim a right to prevent you from </p><p>copying, distributing, performing, displaying or creating derivative </p><p>works based on the work as long as all references to Project Gutenberg </p><p>are removed. Of course, we hope that you will support the Project</p><p>Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by </p><p>freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of </p><p>this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with </p><p>the work. You can easily comply with the terms of this agreement by</p><p>keeping this work in the same format with its attached full Project </p><p>Gutenberg-tm License when you share it without charge with others. </p><p>1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern</p><p>what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in</p><p>a constant state of change. If you are outside the United States, check</p><p>the laws of your country in addition to the terms of this agreement </p><p>before downloading, copying, displaying, performing, distributing or </p><p>creating derivative works based on this work or any other Project </p><p>Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning</p><p>the copyright status of any work in any country outside the United </p><p>States. </p><p>1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:</p><p>1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate</p><p>access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently </p><p>whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the </p><p>phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project </p><p>Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, </p><p>copied or distributed: </p><p>This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with </p><p>almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or</p><p>re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included </p><p>with this eBook or online at www.gutenberg.net </p><p>1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived</p><p>from the public domain (does not contain a notice indicating that it is </p><p>posted with permission of the copyright holder), the work can be copied </p><p>and distributed to anyone in the United States without paying any fees </p><p>or charges. If you are redistributing or providing access to a work</p><p>with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the </p><p>work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 </p><p>through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the </p><p>Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or </p><p>1.E.9. </p><p>1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted</p><p>with the permission of the copyright holder, your use and distribution </p><p>must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional </p><p>terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked</p><p>to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the </p><p>permission of the copyright holder found at the beginning of this work. </p><p>1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm</p><p>License terms from this work, or any files containing a part of this </p><p>work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.</p><p>1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this</p><p>electronic work, or any part of this electronic work, without </p><p>prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with </p><p>active links or immediate access to the full terms of the Project </p><p>Gutenberg-tm License. </p><p>1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,</p><p>compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any </p><p>word processing or hypertext form. However, if you provide access to or</p><p>distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than </p><p>"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version </p><p>posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.net), </p><p>you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a </p><p>copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon </p><p>request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other </p><p>form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm</p><p>License as specified in paragraph 1.E.1. </p><p>1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,</p><p>performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works </p><p>unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. </p><p>1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing</p><p>access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided </p><p>that </p><p>- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from </p><p> the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method</p><p> you already use to calculate your applicable taxes. The fee is</p><p> owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he</p><p> has agreed to donate royalties under this paragraph to the</p><p> Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments</p><p> must be paid within 60 days following each date on which you</p><p> prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax</p><p> returns. Royalty payments should be clearly marked as such and</p><p> sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the</p><p> address specified in Section 4, "Information about donations to</p><p> the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."</p><p>- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies </p><p> you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he</p><p> does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm</p><p> License. You must require such a user to return or</p><p> destroy all copies of the works possessed in a physical medium</p><p> and discontinue all use of and all access to other copies of</p><p> Project Gutenberg-tm works.</p><p>- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any </p><p> money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the</p><p> electronic work is discovered and reported to you within 90 days</p><p> of receipt of the work.</p><p>- You comply with all other terms of this agreement for free </p><p> distribution of Project Gutenberg-tm works.</p><p>1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm</p><p>electronic work or group of works on different terms than are set </p><p>forth in this agreement, you must obtain permission in writing from</p><p>both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael </p><p>Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the</p><p>Foundation as set forth in Section 3 below. </p><p>1.F. </p><p>1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable</p><p>effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread </p><p>public domain works in creating the Project Gutenberg-tm </p><p>collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic</p><p>works, and the medium on which they may be stored, may contain </p><p>"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or </p><p>corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual </p><p>property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a </p><p>computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by </p><p>your equipment. </p><p>1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right</p><p>of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project </p><p>Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project </p><p>Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project </p><p>Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all </p><p>liability to you for damages, costs and expenses, including legal </p><p>fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT</p><p>LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE </p><p>PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE</p><p>TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE </p><p>LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR </p><p>INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH </p><p>DAMAGE. </p><p>1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a</p><p>defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can </p><p>receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a </p><p>written explanation to the person you received the work from. If you</p><p>received the work on a physical medium, you must return the medium with </p><p>your written explanation. The person or entity that provided you with</p><p>the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a </p><p>refund. If you received the work electronically, the person or entity</p><p>providing it to you may choose to give you a second opportunity to </p><p>receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy</p><p>is also defective, you may demand a refund in writing without further </p><p>opportunities to fix the problem. </p><p>1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth</p><p>in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER </p><p>WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO </p><p>WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE. </p><p>1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied</p><p>warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. </p><p>If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the </p><p>law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be </p><p>interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by </p><p>the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any</p><p>provision of this agreement shall not void the remaining provisions. </p><p>1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the</p><p>trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone</p><p>providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance </p><p>with this agreement, and any volunteers associated with the production, </p><p>promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works, </p><p>harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, </p><p>that arise directly or indirectly from any of the following which you do </p><p>or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm </p><p>work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any </p><p>Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause. </p><p>Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm</p><p>Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of </p><p>electronic works in formats readable by the widest variety of computers </p><p>including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists</p><p>because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from </p><p>people in all walks of life. </p><p>Volunteers and financial support to provide volunteers with the </p><p>assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's </p><p>goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will </p><p>remain freely available for generations to come. In 2001, the Project</p><p>Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure </p><p>and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations. </p><p>To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation </p><p>and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 </p><p>and the Foundation web page at http://www.pglaf.org. </p><p>Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive</p><p>Foundation </p><p>The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit </p><p>501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the </p><p>state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal </p><p>Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification</p><p>number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at</p><p>http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg</p><p>Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent </p><p>permitted by U.S. federal laws and your state's laws. </p><p>The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S. </p><p>Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered </p><p>throughout numerous locations. Its business office is located at</p><p>809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email </p><p>business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact</p><p>information can be found at the Foundation's web site and official </p><p>page at http://pglaf.org </p><p>For additional contact information: </p><p> Dr. Gregory B. Newby</p><p> Chief Executive and Director</p><p> gbnewby@pglaf.org</p><p>Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg</p><p>Literary Archive Foundation </p><p>Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide</p><p>spread public support and donations to carry out its mission of </p><p>increasing the number of public domain and licensed works that can be </p><p>freely distributed in machine readable form accessible by the widest </p><p>array of equipment including outdated equipment. Many small donations</p><p>($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt </p><p>status with the IRS. </p><p>The Foundation is committed to complying with the laws regulating </p><p>charities and charitable donations in all 50 states of the United </p><p>States. Compliance requirements are not uniform and it takes a</p><p>considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up </p><p>with these requirements. We do not solicit donations in locations</p><p>where we have not received written confirmation of compliance. To</p><p>SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any </p><p>particular state visit http://pglaf.org </p><p>While we cannot and do not solicit contributions from states where we </p><p>have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition </p><p>against accepting unsolicited donations from donors in such states who </p><p>approach us with offers to donate. </p><p>International donations are gratefully accepted, but we cannot make </p><p>any statements concerning tax treatment of donations received from </p><p>outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.</p><p>Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation </p><p>methods and addresses. Donations are accepted in a number of other</p><p>ways including including checks, online payments and credit card </p><p>donations. To donate, please visit: http://pglaf.org/donate</p><p>Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic</p><p>works. </p><p>Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm </p><p>concept of a library of electronic works that could be freely shared </p><p>with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project</p><p>Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support. </p><p>Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed </p><p>editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S. </p><p>unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily</p><p>keep eBooks in compliance with any particular paper edition. </p><p>Most people start at our Web site which has the main PG search facility: </p><p> http://www.gutenberg.net</p><p>This Web site includes information about Project Gutenberg-tm, </p><p>including how to make donations to the Project Gutenberg Literary </p><p>Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to </p><p>subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks. </p></body></text></TEI>